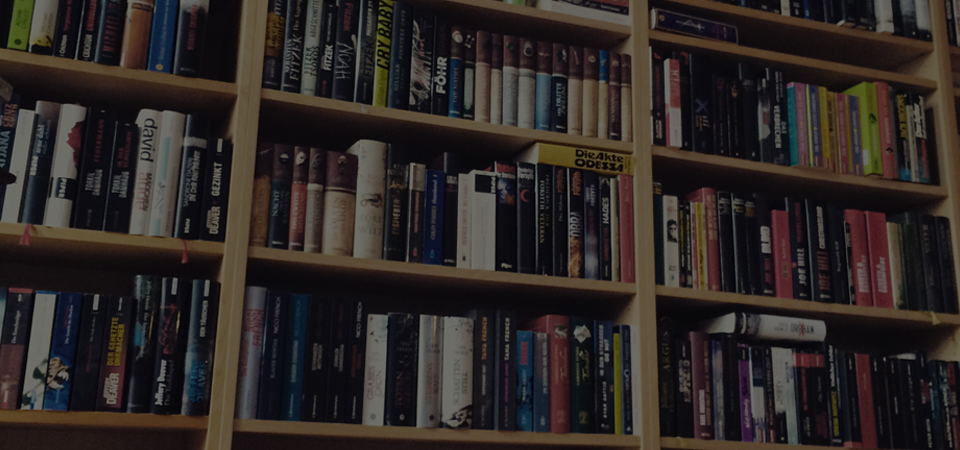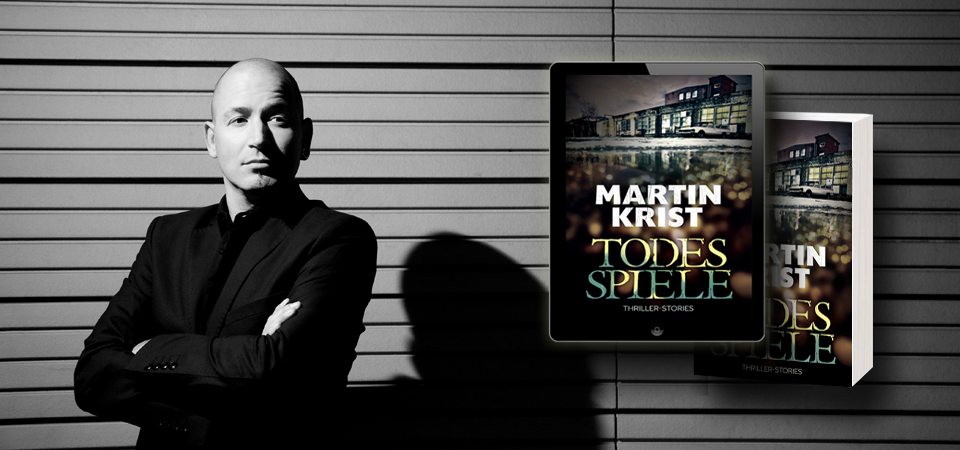My history of bookshelf (48): »Tage der Toten« von Don Winslow
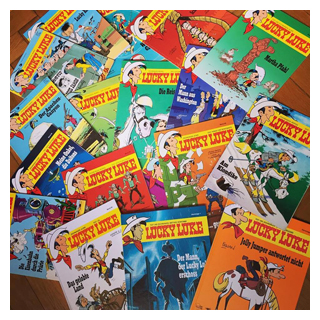 Das Jahr 1977 - Art Keller, Vietnam-Veteran, ist als Fahnder für die DEA im Einsatz, die US-Antidrogenbehörde, für die er in San Diego gegen die weiße Flut aus Mexiko kämpft. Doch die US-Behörden arbeiten träge und ohne den nötigen Biss. Deshalb begibt sich Keller auf eigene Faust nach Mexiko, knüpft Kontakte. Auch zu Adán Barrera, mit dem er sich anfreundet. Dessen Onkel ist Miguel Ángel Barrera, Polizeioffizier und Leibwächter des Gouverneurs von Sinalao, einem kleinen Kaff auf mexikanischer Seite.
Miguel Barrera ist angetan von Kellers Einsatzbereitschaft. Gemeinsam gelingt es den beiden, mit Don Pedro den größten aller Drogenbosse Mexikos zur Strecke zu bringen. Doch Art Kellers Freude über den Erfolg währt nicht lange, denn Miguel Ángel Barrera enthüllt sein wahres Gesicht: Er spielte ein doppeltes Spiel, trieb die Auslöschung von Don Pedro nur deshalb voran, weil er sich selbst an die Spitze aller Drogenkartelle hieven wollte.
Keller ist enttäuscht und macht es sich fortan zur Aufgabe, den Barreras – und somit seinen einstigen Freunden – ins Drogengeschäft zu pfuschen. Dieser beinahe aussichtslose Kampf währt ein Vierteljahrhundert und eigentlich vernichtet Keller dabei nur eines: sich selbst.
Während man als Leser nun folgend Kellers verbissene Bemühungen verfolgt, erlebt man zugleich den faszierenden, schockierenden Aufstieg der Barreras zum mächtigsten Drogenkartell. Man erhält Einblick in die Drogenproduktion, den Drogenschmuggel an die US-Ostküste und nach Florida, von wo die Drogen bis an die Westküste nach New York verfrachtet werden, wo die Mafia-Clans ihre Reviere gegen die Mexikaner verteidigen. Man staunt über die Geldwäsche, die so einfach funktioniert. Und man erschrickt, wie sehr dabei Wirtschaft, Religion und Politik Hand in Hand gehen mit den vermeintlich Kriminellen, die letztlich keinen Deut krimineller sind als die, die sie bekämpfen.
Noch schlimmer aber ist für Art Keller die Erkenntnis, dass er am Ende keinen Deut besser ist als die, die er hasst und bekämpft: für das Erreichen seines Ziels – das Ende der Barrera-Herrschaft – ist ihm irgendwann nicht nur jedes Mittel, sogar jedes Opfer recht. Selbst seine eigene Familie.
»Er weiß, dass ein Mensch, der stark genug ist, das Böse ins Rollen zu bringen, nicht stark genug sein muss, es zu stoppen. Dass es nicht leicht ist, sich des Bösen zu erwehren, dass es aber die schwerste Sache der Welt ist, sich dem Bösen entgegenzustellen. Sich einem Tsunami entgegenzuwerfen.«
Am Ende stellt sich Keller die Frage: War es das wirklich wert?
Eines lohnt sich ganz sicher: diesen Roman zu lesen. »Tage der Toten« ist ein opulentes, glänzend recherchiertes, ja, ein grandioses Buch.
div class="post">
Das Jahr 1977 - Art Keller, Vietnam-Veteran, ist als Fahnder für die DEA im Einsatz, die US-Antidrogenbehörde, für die er in San Diego gegen die weiße Flut aus Mexiko kämpft. Doch die US-Behörden arbeiten träge und ohne den nötigen Biss. Deshalb begibt sich Keller auf eigene Faust nach Mexiko, knüpft Kontakte. Auch zu Adán Barrera, mit dem er sich anfreundet. Dessen Onkel ist Miguel Ángel Barrera, Polizeioffizier und Leibwächter des Gouverneurs von Sinalao, einem kleinen Kaff auf mexikanischer Seite.
Miguel Barrera ist angetan von Kellers Einsatzbereitschaft. Gemeinsam gelingt es den beiden, mit Don Pedro den größten aller Drogenbosse Mexikos zur Strecke zu bringen. Doch Art Kellers Freude über den Erfolg währt nicht lange, denn Miguel Ángel Barrera enthüllt sein wahres Gesicht: Er spielte ein doppeltes Spiel, trieb die Auslöschung von Don Pedro nur deshalb voran, weil er sich selbst an die Spitze aller Drogenkartelle hieven wollte.
Keller ist enttäuscht und macht es sich fortan zur Aufgabe, den Barreras – und somit seinen einstigen Freunden – ins Drogengeschäft zu pfuschen. Dieser beinahe aussichtslose Kampf währt ein Vierteljahrhundert und eigentlich vernichtet Keller dabei nur eines: sich selbst.
Während man als Leser nun folgend Kellers verbissene Bemühungen verfolgt, erlebt man zugleich den faszierenden, schockierenden Aufstieg der Barreras zum mächtigsten Drogenkartell. Man erhält Einblick in die Drogenproduktion, den Drogenschmuggel an die US-Ostküste und nach Florida, von wo die Drogen bis an die Westküste nach New York verfrachtet werden, wo die Mafia-Clans ihre Reviere gegen die Mexikaner verteidigen. Man staunt über die Geldwäsche, die so einfach funktioniert. Und man erschrickt, wie sehr dabei Wirtschaft, Religion und Politik Hand in Hand gehen mit den vermeintlich Kriminellen, die letztlich keinen Deut krimineller sind als die, die sie bekämpfen.
Noch schlimmer aber ist für Art Keller die Erkenntnis, dass er am Ende keinen Deut besser ist als die, die er hasst und bekämpft: für das Erreichen seines Ziels – das Ende der Barrera-Herrschaft – ist ihm irgendwann nicht nur jedes Mittel, sogar jedes Opfer recht. Selbst seine eigene Familie.
»Er weiß, dass ein Mensch, der stark genug ist, das Böse ins Rollen zu bringen, nicht stark genug sein muss, es zu stoppen. Dass es nicht leicht ist, sich des Bösen zu erwehren, dass es aber die schwerste Sache der Welt ist, sich dem Bösen entgegenzustellen. Sich einem Tsunami entgegenzuwerfen.«
Am Ende stellt sich Keller die Frage: War es das wirklich wert?
Eines lohnt sich ganz sicher: diesen Roman zu lesen. »Tage der Toten« ist ein opulentes, glänzend recherchiertes, ja, ein grandioses Buch.
div class="post">
My history of bookshelf (47): »Bosch« von Michael Connelly
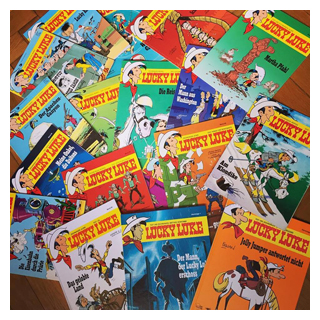 Als Kriminalreporter in Florida hat sich @MichaelConnellyBooks seine ersten Sporen verdient. Eine Interviewserie mit Überlebenden eines Flugzeugabsturzes brachte ihm nicht nur die Nominierung für den Pulitzer ein, sondern auch einen Job als Polizeireporter in Los Angeles. Viele seiner Reportagen sind zusammengefasst in dem Buch "L.A. Crime Report". Die während dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen flossen wiederum ein in seine Kriminalromane um Detective Hieronymus "Harry" Bosch.
Lange Zeit habe ich die Harry Bosch-Krimis sehr gerne gelesen, konsequente, spannende Polizeiarbeit. Später brachte Connelly außerdem den Lincoln Lawyer Michael Haller ins Spiel, einen gewieften Strafverteidiger. Auch dessen Justizfälle lasen sich packend und realistisch. Bis sich herausstellte, dass Haller der Stiefbruder von Bosch ist.
Das Problem: Connelly ist nur dann wirklich gut, wenn er dicht an Boschs Arbeit dran ist, oder Haller bei seinen Winkelzügel folgt. Richtet er sein Augenmerk dagegen auf das Privatleben seiner Figuren, wirken sie häufig nur infantil, langweilig.
Ab da habe ich die Romane nur noch aus Nostalgie gelesen, lustlos, wenig überzeugt, bisweilen erschrocken.
Mit "Ehrensache", sein hierzulande jüngster Harry Bosch-Roman, hat Connelly halbwegs zu alter Stärke zurückgefunden, in dem er sich wieder auf die Ermittlungsarbeit konzentriert. Was im übrigen auch für die von Connelly produzierte Amazon-TV-Serie "Bosch" gilt, für mich eine der besten Polizeiserien gegenwärtig. 😊
div class="post">
Als Kriminalreporter in Florida hat sich @MichaelConnellyBooks seine ersten Sporen verdient. Eine Interviewserie mit Überlebenden eines Flugzeugabsturzes brachte ihm nicht nur die Nominierung für den Pulitzer ein, sondern auch einen Job als Polizeireporter in Los Angeles. Viele seiner Reportagen sind zusammengefasst in dem Buch "L.A. Crime Report". Die während dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen flossen wiederum ein in seine Kriminalromane um Detective Hieronymus "Harry" Bosch.
Lange Zeit habe ich die Harry Bosch-Krimis sehr gerne gelesen, konsequente, spannende Polizeiarbeit. Später brachte Connelly außerdem den Lincoln Lawyer Michael Haller ins Spiel, einen gewieften Strafverteidiger. Auch dessen Justizfälle lasen sich packend und realistisch. Bis sich herausstellte, dass Haller der Stiefbruder von Bosch ist.
Das Problem: Connelly ist nur dann wirklich gut, wenn er dicht an Boschs Arbeit dran ist, oder Haller bei seinen Winkelzügel folgt. Richtet er sein Augenmerk dagegen auf das Privatleben seiner Figuren, wirken sie häufig nur infantil, langweilig.
Ab da habe ich die Romane nur noch aus Nostalgie gelesen, lustlos, wenig überzeugt, bisweilen erschrocken.
Mit "Ehrensache", sein hierzulande jüngster Harry Bosch-Roman, hat Connelly halbwegs zu alter Stärke zurückgefunden, in dem er sich wieder auf die Ermittlungsarbeit konzentriert. Was im übrigen auch für die von Connelly produzierte Amazon-TV-Serie "Bosch" gilt, für mich eine der besten Polizeiserien gegenwärtig. 😊
div class="post">
My history of bookshelf (46): »Affentheater« von Carl Hiaasen
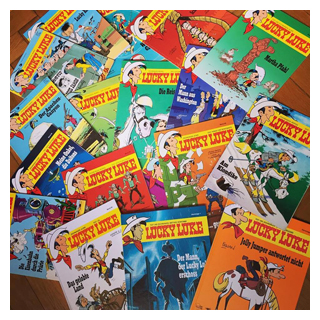 Weil ich’s dieser Tage über mangelnde, vielfarbige Krimi- und Thrillercover hatte - Carl Hiaasen ist da freilich eine Ausnahme. Was kaum verwundert, spielen seine Romane doch allesamt im sonnigen Florida. ☀️🌴
Das sind die Keys, Miami, die Everglades, auf der einen Seite der Golf von Mexiko, auf der anderen der Atlantik, die letzte Bastion der Natur, die Heimat der blauzüngigen Mangowühlmaus, aber eben auch das Pensionistenheim der USA, deshalb ein Paradies für Grundstücksspekulanten und größenwahnsinnige Bauherren.
Es ist kein Geheimnis: Flora und Fauna im Sunshine State werden bedroht von raffgierigen Geschäftsleuten und korrupten Politikern. Dass sie bei Carl Hiaasen in der Regel auch noch tumb auftreten, macht seine Romane auf den ersten Blick zu skurrilen Satiren. Zwischen den Zeilen allerdings legt Hiaasen, der selbst in Florida lebt, die Finger in die Wunde: "Die Gier wird immer die schlimmste Seuche in Florida bleiben. Es wird immer schlaue Leute geben, die Feuchtgebiete für noch mehr Wohnblöcke und Einkaufszentren trockenlegen wollen. Natürlich macht mich die Kriminalität und Korruption wahnsinnig, aber ich nehme sie als Herausforderung in meinen Büchern immer wieder neue Herangehensweisen zu finden, damit umzugehen."
Natürlich haben Hiaasens Kritiker recht, wenn sie behaupten, viele seiner Bücher gleichen einander meist wie ein Ei. Aber das macht ihre Botschaft nicht minder wichtig. Für mich als Florida-Liebhaber sind sie obendrein immer eine schöne Erinnerung an den letzten Urlaub auf Key Largo. 😊
Weil ich’s dieser Tage über mangelnde, vielfarbige Krimi- und Thrillercover hatte - Carl Hiaasen ist da freilich eine Ausnahme. Was kaum verwundert, spielen seine Romane doch allesamt im sonnigen Florida. ☀️🌴
Das sind die Keys, Miami, die Everglades, auf der einen Seite der Golf von Mexiko, auf der anderen der Atlantik, die letzte Bastion der Natur, die Heimat der blauzüngigen Mangowühlmaus, aber eben auch das Pensionistenheim der USA, deshalb ein Paradies für Grundstücksspekulanten und größenwahnsinnige Bauherren.
Es ist kein Geheimnis: Flora und Fauna im Sunshine State werden bedroht von raffgierigen Geschäftsleuten und korrupten Politikern. Dass sie bei Carl Hiaasen in der Regel auch noch tumb auftreten, macht seine Romane auf den ersten Blick zu skurrilen Satiren. Zwischen den Zeilen allerdings legt Hiaasen, der selbst in Florida lebt, die Finger in die Wunde: "Die Gier wird immer die schlimmste Seuche in Florida bleiben. Es wird immer schlaue Leute geben, die Feuchtgebiete für noch mehr Wohnblöcke und Einkaufszentren trockenlegen wollen. Natürlich macht mich die Kriminalität und Korruption wahnsinnig, aber ich nehme sie als Herausforderung in meinen Büchern immer wieder neue Herangehensweisen zu finden, damit umzugehen."
Natürlich haben Hiaasens Kritiker recht, wenn sie behaupten, viele seiner Bücher gleichen einander meist wie ein Ei. Aber das macht ihre Botschaft nicht minder wichtig. Für mich als Florida-Liebhaber sind sie obendrein immer eine schöne Erinnerung an den letzten Urlaub auf Key Largo. 😊
My history of bookshelf (45): »Morgen wird's was geben« von James Patterson
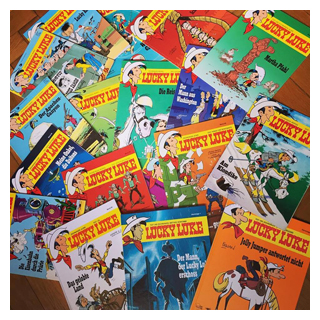 Okay, ich geb's zu, eine Zeit lang habe ich die Romane von James Patterson verschlungen wie nichts, vor allem seine Bücher um den Polizeipsychologen Dr. Alex Cross in Washington D.C. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber damals waren die Thriller sowas wie ein Maßstab für mich, die Essenz dessen, was gutes, spannendes Schreiben ausmacht: "Ich bin schnell", sagt Patterson über sich selbst, "ich bin ein Ja-Nein-Typ, ich hasse Vielleichts." Das merkte man auch seinen Geschichten an: kurze Kapitel, Cliffhanger, eine knackige Sprache, viele Wendungen, ein hohes Tempo, und niemals viel drumherum. Auf den Punkt. Lange Zeit - perfekt.
Okay, ich geb's zu, eine Zeit lang habe ich die Romane von James Patterson verschlungen wie nichts, vor allem seine Bücher um den Polizeipsychologen Dr. Alex Cross in Washington D.C. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber damals waren die Thriller sowas wie ein Maßstab für mich, die Essenz dessen, was gutes, spannendes Schreiben ausmacht: "Ich bin schnell", sagt Patterson über sich selbst, "ich bin ein Ja-Nein-Typ, ich hasse Vielleichts." Das merkte man auch seinen Geschichten an: kurze Kapitel, Cliffhanger, eine knackige Sprache, viele Wendungen, ein hohes Tempo, und niemals viel drumherum. Auf den Punkt. Lange Zeit - perfekt.
Dann allerdings beging Patterson, meiner Meinung nach, zwei Fehler: Er ließ seinen Dr. Alex Cross mitsamt Familie immer mehr und häufiger selbst ins Visier der Kriminellen geraten, und zwar auf die allerübelsten Weisen. Das wurde auf Dauer durchschaubar, öde, unlesbar. Irgendwann bin ich ausgestiegen.
Außerdem, und das noch schlimmer, begann Patterson sich als eine Schreibfabrik zu vermarkten - er arbeitete an mehreren Romanen gleichzeitig, was man den schluddrigen Texten anmerkte. Darüber hinaus vergab er das eigentliche Schreiben an andere Autoren. Die konnten die Patterson-Bausatzplots leider auch nicht mehr retten.
James Patterson: Morgen wird's was geben (1993)
My history of bookshelf (44): »Die Akte« von John Grisham
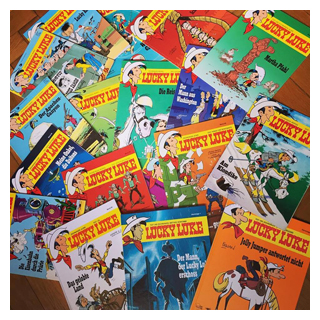 Was habe ich seine Thriller verschlungen: »Der Regenmacher«, »Die Firma«, »Die Akte«, noch eine Menge mehr. Und allesamt erfolgreich fürs Kino verfilmt. Aber das ist lange her. Kinofilme nach Grisham gibt es nicht mehr, spannend sind seine Romane ebenso wenig. Heute lesen sie sich eher wie Dokumentationen, einen Plot sucht man vergeblich, dito bewegende Charaktere, die Bücher ziehen sich wie alter Käse. Jahrelang habe ich ihnen trotzdem die Treue gehalten, aus alter Verbundenheit. Aber den neuen, »Forderung«, habe ich nicht mehr gekauft. Beim besten Willen, es lohnt nicht mehr.
Was habe ich seine Thriller verschlungen: »Der Regenmacher«, »Die Firma«, »Die Akte«, noch eine Menge mehr. Und allesamt erfolgreich fürs Kino verfilmt. Aber das ist lange her. Kinofilme nach Grisham gibt es nicht mehr, spannend sind seine Romane ebenso wenig. Heute lesen sie sich eher wie Dokumentationen, einen Plot sucht man vergeblich, dito bewegende Charaktere, die Bücher ziehen sich wie alter Käse. Jahrelang habe ich ihnen trotzdem die Treue gehalten, aus alter Verbundenheit. Aber den neuen, »Forderung«, habe ich nicht mehr gekauft. Beim besten Willen, es lohnt nicht mehr.
My history of bookshelf (43): »Das Schweigen der Lämmer« von Thomas Harris
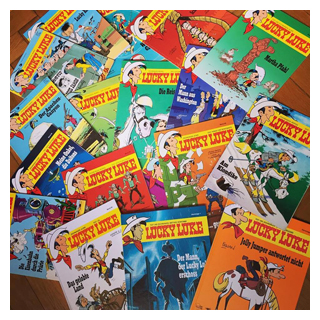 Mit Sicherheit hat Thomas Harris den Serienkiller nicht erfunden, in seinem Thriller "Das Schweigen der Lämmer" aber sowas wie den populärsten, weil raffiniertesten seiner Art geschaffen (und für eine Serienkillerthrillerflut gesorgt, die bis heute anhält). Selbstverständlich verdankt Hannibal Lecter seine Berühmtheit auch der Romanverfilmung, in der Anthony Hopkins kongenial seine Rolle fürs Lebens gefunden hat. Von da an war er immer wieder auf Lecter oder auf die Darstellung gerissener Killer abonniert.
Mit Sicherheit hat Thomas Harris den Serienkiller nicht erfunden, in seinem Thriller "Das Schweigen der Lämmer" aber sowas wie den populärsten, weil raffiniertesten seiner Art geschaffen (und für eine Serienkillerthrillerflut gesorgt, die bis heute anhält). Selbstverständlich verdankt Hannibal Lecter seine Berühmtheit auch der Romanverfilmung, in der Anthony Hopkins kongenial seine Rolle fürs Lebens gefunden hat. Von da an war er immer wieder auf Lecter oder auf die Darstellung gerissener Killer abonniert.
Aber zurück zum Roman, der bereits furios beginnt, indem wir dank Lecters aufmerksamer Augen mit nur wenigen Worten alles Wichtige über seinen FBI-Widerpart Clarice Starling erfahren: »Sie sind so ehrgeizig, nicht? Wissen Sie, wie sie mir vorkommen, mit Ihrer guten Tasche und Ihren billigen Schuhen? Sie sehen wie ein Bauerntrampel aus. Sie sind ein gut geschrubbter, hastender Bauerntrampel mit ein bisschen Geschmack. Ihre Augen sind wie billige Geburtssteine - einer Oberflächenglanz, wenn Sie sich an eine unbedeutende Anwort heranpirschen. Und hinter ihnen sind Sie gescheit, oder? Verzweifelt darauf bedacht, nicht wie Ihre Mutter zu sein.«
Worte wie Ohrfeigen, doch es ist eben dieses Psychoduell, mit dem Lecter Starling schließlich zu einem echten Edelstein schleift. Großartig!
Übrigens: Am Beispiel des Prequels »Roter Drache« zeigt sich mal wieder all die Absurdität der Verlage. »So gut wie ›Der Pate‹«, blurpt Stephen King auf dem Cover. Einen Serienkillerthriller mit einem Mafiadrama zu vergleichen, das ist ungefähr so hanebüchen wie ... wie ein Jack Reacher-Buch mit einem Harry Bosch-Roman. Beide ziemlich gut, aber trotzdem völlig anders.
Thomas Harris: Das Schweigen der Lämmer (1988)
My history of bookshelf (51): »Kommissar Beck« von Sjöwall/Wahlöö
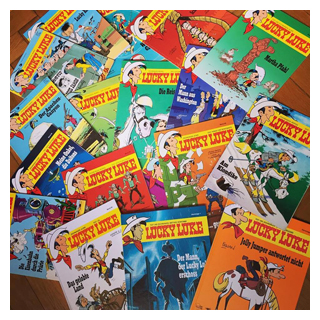 Die meisten kennen Kommissar Beck nur noch durch die gleichnamige Fernsehserie mit Peter Haber in der Hauptrolle und dem eindrucksvollen Mikael Persbrandt in der Rolle des Haudrauf Gunvald Larsson. Tatsächlich aber geht die TV-Serie, zu der alsbald neue Episoden ausgestrahlt werden sollen, zurück auf die zehnbändige Romanreihe aus der Feder des Schwedenduos Mai Sjöwall und Per Wahlöö.
Die meisten kennen Kommissar Beck nur noch durch die gleichnamige Fernsehserie mit Peter Haber in der Hauptrolle und dem eindrucksvollen Mikael Persbrandt in der Rolle des Haudrauf Gunvald Larsson. Tatsächlich aber geht die TV-Serie, zu der alsbald neue Episoden ausgestrahlt werden sollen, zurück auf die zehnbändige Romanreihe aus der Feder des Schwedenduos Mai Sjöwall und Per Wahlöö.
Die beiden sind mit ihren sozialkritischen, politischen Beck-Krimis sowas wie die Vorreiter des heutigen Krimibooms aus Skandinavien. »Per und ich wussten natürlich«, so erinnerte sich Sjöwall kürzlich in einem Interview, »dass wir mit unseren Büchern die Welt nicht würden verändern können. Aber wir wollten die Leser zumindest davor warnen, dass die Gesellschaft inhumaner werden und dass der Kapitalismus überhandnehmen würde. Heute muss ich leider sagen, dass wir Recht behalten haben – nur, dass die Entwicklung noch viel schneller vonstatten ging, als wir ursprünglich befürchtet hatten. Heutzutage leben wir in einer reinen Konsumgesellschaft.«
Ironischerweise hat diese Konsumgesellschaft ausgerechnet auch den Skandinavien-Krimi ereilt. Auf Sjöwall und Wahlöö folgte bis heute eine wahre Flut an »neuen Stars aus Schweden, Norwegen, Dänemark oder Island«, wie die Verlage alle halbe Jahre vollmündig anpreisen. Doch das, was heute aus dem Norden den Markt überschwemmt, ist in den seltensten Fällen noch sozialkritisch, geschweige denn politisch, sondern nur blutiges, in den meisten Fällen langweiliges Einerlei. Auch Sjöwall ist überzeugt, »dass viele dieser Skandinavien-Krimis schlichtweg schlecht geschrieben sind«.
Wer sich für die Beck-Krimis interessiert: der Rowohl Verlag hat die zehn Romane unlängst neuübersetzt und -veröffentlicht.
Mai Sjöwall/Per Wahlöö: Die Tote im Götakanal (1965)
My history of bookshelf (50): »Der Pate« von Mario Puzo
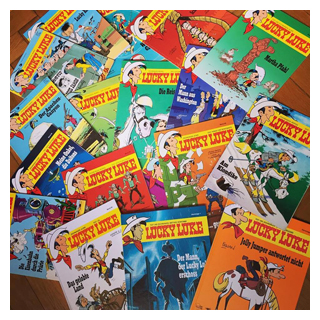 Was man tunlichst vermeiden sollte - erst die Verfilmung gucken, dann das Buch lesen. Dummerweise habe ich diesen Ratschlag als Teenager nicht beherzigt und mir erst Francis Ford Coppolas großartigen Dreiteiler mit den noch großartigeren Al Pacino, Robert de Niro sowie Marlon Brando angeguckt.
Was man tunlichst vermeiden sollte - erst die Verfilmung gucken, dann das Buch lesen. Dummerweise habe ich diesen Ratschlag als Teenager nicht beherzigt und mir erst Francis Ford Coppolas großartigen Dreiteiler mit den noch großartigeren Al Pacino, Robert de Niro sowie Marlon Brando angeguckt.
Damit wir uns nicht missverstehen: Mario Puzos Roman um die fiktive, aus dem sizilianischen Dorf Corleone stammenden New Yorker Mafiafamilie Corleone und deren »Gewalt, Sex, Geld, Freundschaft, Liebe« ist gut - wenngleich auch ganz eigen. Vielleicht kann das Buch gerade deshalb einfach nicht gegen die Filme anstinken.
Ich für meinen Teil konnte mich jedenfalls mehr für »Der Sizilianer« begeistern, sowas wie ein Spin Off zur Corleone-Saga, die Geschichte Salvatore Giulianos, der im Auftrag Don Corleones für das sichere Geleit dessen Sohnes Michael Corleones sorgen soll, der am Schluss von »Der Pate« nach Sizilien fliehen musste. Doch Salvatore umgibt sein ganz eigener Mythos.
Mario Puzo: Der Pate (1969)
My history of bookshelf (49): »Der talentierte Mr. Ripley« von Patricia Highsmith
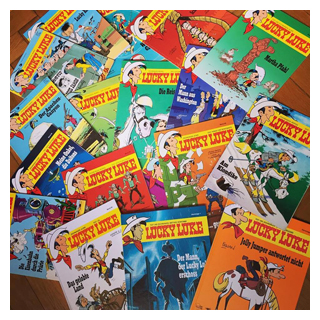 Als »abstoßend und faszinierend« charakterisierte ihn die Literaturkritik, diesen Tom Ripley, dessen fünf Romane zweifellos zu den populärsten seiner Schöpferin Patricia Highsmith gehören. Und das, obwohl sie bei Erscheinen des ersten Bands, »Der talentierte Mr. Ripley«, konsequent mit den bis dahin eisernen Genreregeln brach: Ihr ging's nicht um das Whodunit, die Aufklärung des Verbrechens, sondern um das Whydunit, die Umstände und Motive, die Menschen ins Verbrechen treiben.
Als »abstoßend und faszinierend« charakterisierte ihn die Literaturkritik, diesen Tom Ripley, dessen fünf Romane zweifellos zu den populärsten seiner Schöpferin Patricia Highsmith gehören. Und das, obwohl sie bei Erscheinen des ersten Bands, »Der talentierte Mr. Ripley«, konsequent mit den bis dahin eisernen Genreregeln brach: Ihr ging's nicht um das Whodunit, die Aufklärung des Verbrechens, sondern um das Whydunit, die Umstände und Motive, die Menschen ins Verbrechen treiben.
In diesem Fall eben jenen jungen Tom Ripley, der sich in New York mehr schlecht als rechts durchs Leben schlägt, bis ihn der reiche Werftbesitzer Herbert Greenleaf bittet, seinen nicht minder herumschlarwenzelnden Sohn Dickie aus Italien zurückzuholen. Die weitere Geschichte ist bekannt (und zweifach verfilmt, 1960 als »Nur die Sonne war Zeuge« mit Alain Delon, 1999 als »Der talentierte Mr. Ripley« mit Matt Damon): Verschlagen schleicht sich Tom in Dickies Leben, bis er ihn schließlich nicht nur erschlägt, um dessen Leben zu übernehmen, sondern damit auch noch davonkommt.
Verbrecher, so betonte Highsmith, interessierten sie aus Gründen der Dramatik, »weil sie mindenstes eine Zeitlang aktiv, geistig frei sind und sich vor niemandem beugen. Ich finde die Leidenschaft der Öffentlichkeit für das Gesetz ziemlich langweilig und gekünstelt, denn weder das Leben noch die Natur kümmern sich um Gerechtigkeit«.
Es folgten noch vier weitere Ripley-Romane.
Patricia Highsmith: Der talentierte Mr. Ripley (1955)
My history of bookshelf (48): »Jurassic Park« von Michael Crichton
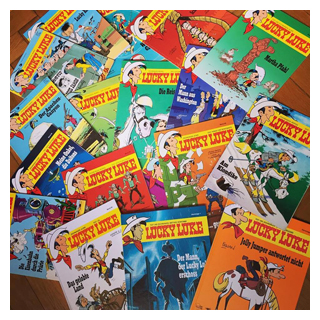 Wohl kaum ein Autor, der derart erfolgreich zwischen den Thriller-, Science Fiction- und Wissenschaftsgenres switchte, sie obendrein häufig massenkompatibel miteinander vermengte, und dies dann auch noch als Schrifsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Viele seiner Bücher wurden erfolgreich fürs Kino verfilmt, allen voran natürlich der Dino-Meilenstein »Jurassic Park«, außerdem »Congo«, »Sphere«, »Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All« und »Enthüllung«, in dem er das Thema sexuelle Belästigung aufgreift - nur mit vertauschten Rollen.
Wohl kaum ein Autor, der derart erfolgreich zwischen den Thriller-, Science Fiction- und Wissenschaftsgenres switchte, sie obendrein häufig massenkompatibel miteinander vermengte, und dies dann auch noch als Schrifsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Viele seiner Bücher wurden erfolgreich fürs Kino verfilmt, allen voran natürlich der Dino-Meilenstein »Jurassic Park«, außerdem »Congo«, »Sphere«, »Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All« und »Enthüllung«, in dem er das Thema sexuelle Belästigung aufgreift - nur mit vertauschten Rollen.
Meist stammten auch die Drehbücher von ihm, außerdem zu Kinofilmen wie »Westworld«, »Coma«, »Der große Eisenbahnraub«, »Die Wiege der Sonne«, bei denen er sogar Regie führte. Nur die wenigsten wissen, dass er mit einem Drehbuch auch der Schöpfer der TV-Serie »Emergency Room« war.
Einzig für sein Spätwerk »Welt in Angst« musste er nicht wenig Kritik einstecken, weil er darin die Befürchtung äußerte, dass Umweltverbände in Zeiten knapper Kassen mit inszenierten Katastrophen die Angst der Menschen schüren, um auch in Zukunft ihre Zuschüsse zu bekommen. Aber so war Crichton: Er liebte nicht nur ausgeklügelte Science-Suspense, er hatte auch einen außerordentlichen Hang zur Kontroverse.
Michael Crichton: Jurassic Park (1990)
My history of bookshelf (47): »Der Schakal« von Frederick Forsyth
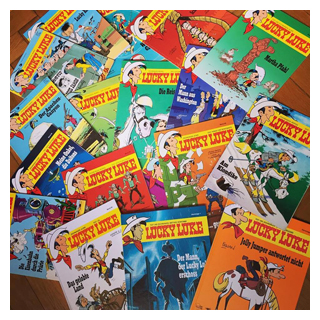 Drei Bücher, die maßgeblich meine Begeisterung für Politthriller geweckt haben - und alle ausgerechnet aus der Feder von Frederick Forsyth, der sich, angefangen als Reporter an den Krisenherden dieser Welt, schließlich als Agent für den britischen Nachrichtendienst MI6 anwerben ließ. Er weiß also, worüber er schreibt.
Drei Bücher, die maßgeblich meine Begeisterung für Politthriller geweckt haben - und alle ausgerechnet aus der Feder von Frederick Forsyth, der sich, angefangen als Reporter an den Krisenherden dieser Welt, schließlich als Agent für den britischen Nachrichtendienst MI6 anwerben ließ. Er weiß also, worüber er schreibt.
Bereits sein erstes Roman »Der Schakal« über den gleichnamigen Profikiller, der im Auftrag der Untergrundorganisation OAS den französischen Premierminister de Gaulle töten soll, brachte Forsyth als Schriftsteller den Durchbruch und wurde zweimal verfilmt: 1973 werkgetreu mit Edward Fox, 1997 nur noch vage an der Vorlage orientiert mit Bruce Willis. Aber das Buch ist sowieso besser.
Weniger gut weggekommen vor allem bei den deutschen Kritikern ist dagegen die »Akte Odessa«, eine Organisation ehemaliger SS-Angehöriger, die nach dem Krieg ihr braunes Süppchen kocht. Aber in Sachen Verleugnung waren (und sind) wir Deutschen ja sowieso schon immer meisterlich.
»Der Unterhändler« ist einer dieser Romane, die ich innerhalb einer Nacht weggelesen habe: 1989 erschienen trifft er den Nerv jener Zeit: Während sich der russische Präsident Gorbatschow und sein US-Pendant über das Ende des Kalten Krieges verständigen, versuchen finstere Mächte die Verhandlungen zu torpedieren und entführen kurzerhand den Sohn des amerikanischen Präsidenten. Der eigenwillige Unterhändler Quinn soll's richten.
Frederick Forsyth: Der Schakal (1972), Die Akte Odessa (1973), Der Unterhändler (1989)
My history of bookshelf (46): »The Far Side« von Gary Larson
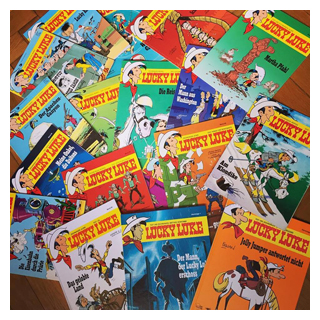 Zum ersten Mal entdeckt habe ich Gary Larson in den 80-ern im Stern, als der Stern noch ein lesenswertes, da informatives Magazin war. Die abgründigen, abseitigen Cartoons - die nicht ganz zufällig unter dem Motto »The Far Side« standen - waren jede Woche mein Highlight: meist Tiere, die die komplette Tragik unseres menschlichen Daseins auf die Schippe nahmen. Larsons pointierte, manche behaupteten: literarische, Bildunterschriften, setzten das Sahnehäubchen.
Zum ersten Mal entdeckt habe ich Gary Larson in den 80-ern im Stern, als der Stern noch ein lesenswertes, da informatives Magazin war. Die abgründigen, abseitigen Cartoons - die nicht ganz zufällig unter dem Motto »The Far Side« standen - waren jede Woche mein Highlight: meist Tiere, die die komplette Tragik unseres menschlichen Daseins auf die Schippe nahmen. Larsons pointierte, manche behaupteten: literarische, Bildunterschriften, setzten das Sahnehäubchen.
Irgendwann war dann leider Schluss mit seinem grostesken Humor. 1995 hängte Larson, von wenigen Ausnahmen abgesehen, seinen Zeichenstift an den Nagel. Schade.
Seine Bücher indes haben noch einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek.
Gary Larson: Wenn Piranhas auswärts essen (2000)
My history of bookshelf (45): »Der Adel ist gelandet« von Jack Higgins
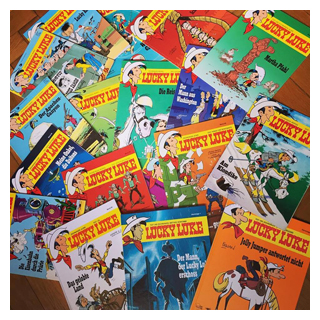 Kennt (oder liest) eigentlich noch irgendjemand Jack Higgins? Vermutlich nicht. Schade. Denn der britische Autor, geboren als Harry Patterson, hat durchaus sein Handwerverstanden. Ich für meinen Teil konnte von seiner Mischung aus Action- und Spionagethriller lange Zeit nicht genug bekommen. Häufig verarbeitete er in seinen Romanen die Erfahrung mit dem Nordirland-Konflikt, den er hautnah erlebte, als er mit seiner Mutter in Belfast lebte, aber auch während seiner Armeezeit. Einer seiner bekanntesten Romane ist »Auf den Schwingen des Todes«, verfilmt mit Mickey Rourke.
Kennt (oder liest) eigentlich noch irgendjemand Jack Higgins? Vermutlich nicht. Schade. Denn der britische Autor, geboren als Harry Patterson, hat durchaus sein Handwerverstanden. Ich für meinen Teil konnte von seiner Mischung aus Action- und Spionagethriller lange Zeit nicht genug bekommen. Häufig verarbeitete er in seinen Romanen die Erfahrung mit dem Nordirland-Konflikt, den er hautnah erlebte, als er mit seiner Mutter in Belfast lebte, aber auch während seiner Armeezeit. Einer seiner bekanntesten Romane ist »Auf den Schwingen des Todes«, verfilmt mit Mickey Rourke.
Mich allerdings haben nachhaltig zwei andere seiner Geschichten fasziniert: »Der Adler ist gelandet«, der angeblich auf wahre Tatsachen beruht (aber das ist bis heute nicht bewiesen): Angeblich hat Adolf Hitler seinerzeit die Operation Adler ins Leben gerufen, 15 Soldaten mit dem Auftrag, Churchill zu entführen, um ein Druckmittel gegen die Engländer zu haben. Ob wahr oder nicht, ein unglaublich spannender Thriller (und ebenfalls verfilmt).
Was auch für »Der Tag, an dem John Dillinger starb«. Ein weiterer Roman, der offenbar auf wahre Tatsachen beruht und mit dem Higgins das Leben und Sterben des amerikanischen Staatsfeindes Nummer 1 nachzeichnete.
Jack Higgins: Der Adler ist gelandet (1975) / Der Tag, an dem John Dillinger starb (1983)
My history of bookshelf (44): »Die Nadel« von Ken Follett
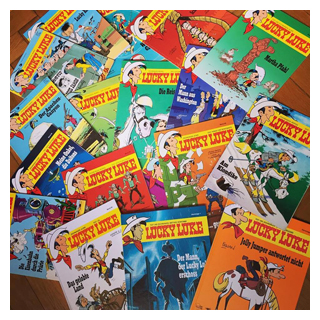 Mittlerweile hat er sich einen Namen als Chronist mittelalterlicher Dramen gemacht, "Die Säulen der Erde", "Die Tore der Welt", "Das Fundament der Ewigkeit", seitenschwere Schwarten, die allesamt noch ungelesen in meinem Regal stehen. Seinen weltweiten Durchbruch aber erlebte Ken Follett mit lupenreinen Thrillern, allen voran natürlich "Die Nadel", seinerzeit verfilmt mit Donald Sutherland.
Mittlerweile hat er sich einen Namen als Chronist mittelalterlicher Dramen gemacht, "Die Säulen der Erde", "Die Tore der Welt", "Das Fundament der Ewigkeit", seitenschwere Schwarten, die allesamt noch ungelesen in meinem Regal stehen. Seinen weltweiten Durchbruch aber erlebte Ken Follett mit lupenreinen Thrillern, allen voran natürlich "Die Nadel", seinerzeit verfilmt mit Donald Sutherland.
Auch ich habe Follett mit diesem Roman für mich entdeckt: 1944, der deutsche Spion Faber, wegen seiner Tötungsmethode "Die Nadel" genannt, hat herausgefunden, dass die Landung der Allierten anstatt in Calais in der Normandie stattfinden soll. Auf der Flucht mit den Beweisen strandet er auf einer kleinen schottischen Insel beim Ehepaar Rose. Der ehemalige Jagdflieger David Rose sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl, seine Frau Lucy ist dementsprechend frustriert. Faber lässt sich auf eine Affäre mit ihr ein, während ihr misstrauischer Ehemann ihm auf die Schliche kommt. Das Drama nimmt seinen Lauf.
Während die Krimikritik auch an Follett in schöner Regelmäßigkeit kein gutes Haar lässt, wage ich zu behaupten: Eine gute Thrillergeschichte darf auch mal alle Fünfe gerade sein lassen, solange sie handwerklich gut gemacht und obendrein unterhaltsam ist. Darauf versteht sich Follett nämlich perfekt.
Ken Follett: Die Nadel (1978)
My history of bookshelf (44): »Vaterland« von Robert Harris
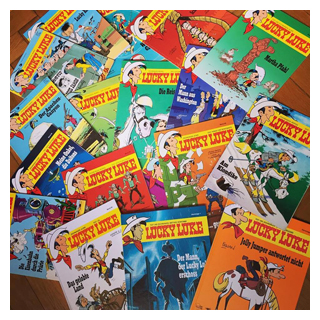 Jüngst hielt ein »Krimiexperte« den britischen Autor Robert Harris für »weit überschätzt«, und dessen Bücher für »Holzschnittprosa, ohne Pointe, ohne Clou. Guido-Knopp-Geschichte mit Laiendarstellern. Einschlafhilfe.« Kann man so sehen, muss man aber nicht. Harris’ Romane, die er in schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht, stehen für spannende Unterhaltung vor historisch ausgefeilter Kulisse.
Jüngst hielt ein »Krimiexperte« den britischen Autor Robert Harris für »weit überschätzt«, und dessen Bücher für »Holzschnittprosa, ohne Pointe, ohne Clou. Guido-Knopp-Geschichte mit Laiendarstellern. Einschlafhilfe.« Kann man so sehen, muss man aber nicht. Harris’ Romane, die er in schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht, stehen für spannende Unterhaltung vor historisch ausgefeilter Kulisse.
Entdeckt habe ich Harris, wie wohl fast jeder, einst mit »Vaterland« - einer Was-Wäre-Wenn-Geschichte. Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte?
Dessen Großdeutschland, vom Rhein bis zum Ural, liegt im Kalten Krieg mit den USA, als der Mord an einem Parteibonzen geschieht. Ausgerechnet Kommissar Xavier March soll ermitteln. Doch der hegt längst Zweifel am System. »Vaterland« ist mehr als ein klassischer Krimi, stattdessen ein Verschwörungsthriller von zeitloser und (mehr denn je) beklemmender Aktualität. Die Verfilmung mit Rutger Hauer (1994) dagegen hat inzwischen einiges an Staub angesetzt.
Robert Harris: Vaterland (1992)
My history of bookshelf (42): »Lucky Luke« von Goscinny & Morris
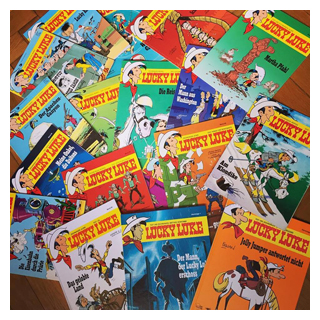 »I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home ...«, singt Lucky Luke am Ende jedes seiner Abenteuer. Was glatt gelogen ist. Denn egal wo er mit seinem sprechenden Pferd Jolly Jumper auftaucht, warten Freunde.
»I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home ...«, singt Lucky Luke am Ende jedes seiner Abenteuer. Was glatt gelogen ist. Denn egal wo er mit seinem sprechenden Pferd Jolly Jumper auftaucht, warten Freunde.
Lucky Luke ist der glorreiche Westernheld. Wohl niemand, der schneller zum Colt greift. Er schießt schneller als sein Schatten. Und sollte der Revolver mal nicht weiterhelfen, kann Lucky Luke auch anders: Er schlüpft in die Hauptrolle des Weißen Kavaliers. Arbeit als Redakteur des »Daily Star«. So oder anders lehrt er dem Kopfgeldjäger Elliot Belt das Fürchten, weist Bandenchef Joss Jamon in seine Schranken, verhilft den Einwohnern von Nothing Gulch zu mehr Selbstachtung im Kampf gegen Jesse James. Selbst vor Billy the Kid zeigt er wenig Respekt: Er versohlt dem Buben den Hintern - endlich ist Ruhe im Laufstall. Einzig die Dalton Brüder, die schlimmste Bande überhaupt, schreckt nicht vor ihm zurück. Leider durchkreuzt der räudige Rantanplan meist ihre heimtückischen Pläne.
Neben den der realen Wildwest-Historie entliehenen Figuren wie den Daltons, Billy the Kid, Jesse James, Calamity Jane, Roy Bean oder Sarah Bernhardt und den Karikaturen vieler Filmpersönlichkeiten wie Lee van Cleef, Jack Palance, Robert Mitchum, Sean Connery und Alfred Hitchcock wird vor allem die klassische Schlußszene zum Markenzeichen der Serie.
Erstmals erschienen 1946 die von Zeichner Morris entwickelten Cartoons, amüsant, aber nicht weltbewegend. Erst als sich Morris in Amerika einen Eindruck vom »Wilden Westen« machte, außerdem auf Asterix-Schöpfer René Goscinny traf, der ab 1955 die Skripte für »Lucky Luke« übernahm, war der Cowboy erfolgreich - nicht nur als Comic, auch als Trickfilm, Realfilm und sonstigem Merchandise. Viel hat sich seither nicht verändert - einzig Lucky Lukes Zigarette. Aus Jugendschutzgründen musste sie einem Grashalm weichen.
Morris & Goscinny: Die Eisenbahn durch die Prärie (1955)
My history of bookshelf (41): »Asterix« von Goscinny & Uderzo
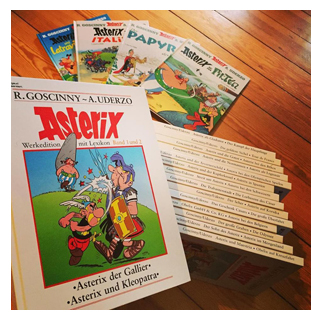 »Asterix« – die Kombination aus dem griechischen »Asteriskus« (= Sternchen), das in der französischen Sprache zu »astérisque« wird, und dem Keltenfürsten Vercingetorix (82–46 v.Chr.), unter dessen Führung sich Gallien 52. v. Chr. gegen die Römer erhob. Allerdings unterlag er und ganz Gallien war besetzt ...
»Asterix« – die Kombination aus dem griechischen »Asteriskus« (= Sternchen), das in der französischen Sprache zu »astérisque« wird, und dem Keltenfürsten Vercingetorix (82–46 v.Chr.), unter dessen Führung sich Gallien 52. v. Chr. gegen die Römer erhob. Allerdings unterlag er und ganz Gallien war besetzt ...
Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf leistet Widerstand - dank des Zaubertranks seines weisen Druiden Miraculix, der unbesiegbar macht. Totzdem glaubt Majestix, das tolpatschige Dorfoberhaupt, der Himmel würde ihnen bald auf den Kopf fallen. Der Fischhändler Verleihnix, dessen Fische fürchterlich stinken, liegt stattdessenmit dem Waffenschmied Automatix in den Haaren. Mit dabei der greise Methusalix, Ehemann ausgerechnet der schönsten Frau im Dorf.
So amüsant diese Episoden sind, im Mittelpunkt der gallischen Ereignisse stehen Asterix, sein dicker Freund Obelix (»Ich bin nicht dick, höchstens ein bisschen muskulös!«) und ihr Hündchen Idefix, deren Abenteuer sie von den Indianern zu den Schweizern, von den Korsen zu den Gothen führen, manchmal auch vor den Thron Cäsars, der mit der hübschnäsigen Kleopatra viel lieber ein tête à tête hätte. Ihre Geschichten enden mit einem zünftigen Festbankett, zu dem der unmusikalische Barde Troubadix gefesselt und weggesperrt wird.
Ende der 50er Jahre von Zeichner Albert Uderzo und Autor René Goscinny als französische Antwort auf die amerikanischem Comics erfunden, war das erste Abenteuer »Asterix der Gallier« der Anfang einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Die erste deutsche Übersetzung erschien unter »Siggi & Babarras«, die unbeugsamen Germanen. Goscinny und Uderzo wehrten sich gegen diese Verfälschung und entzogen die Nachdruckrechte.
Nach dem Tod Goscinnys 1977 führte Uderzo die Serie alleine fort, nach wie vor mit ungeheurem Erfolg, die inhaltliche Qualität ließ allerdings zu wünschen übrig. Erst seit wenigen Jahren haben Autor Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad übernommen. Seitdem wird alles besser, auch wenn es nicht mehr an den tiefsinnigen Esprit eines Goscinny heranreicht.
Albert Uderzo & René Goscinny: Asterix der Gallier (1959)
My history of bookshelf (40): »Tim & Struppi« von Hergé
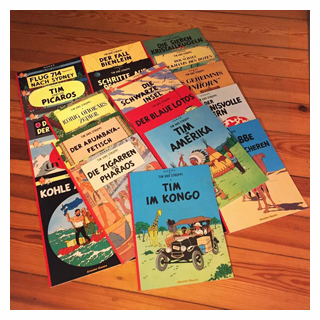 Wer kennt ihn nicht? Tim, jener junge Mann mit der fliegenden roten Haartolle, Held des Abenteuer-Comics, Fossil der Comic-Geschichte, zeitlos wie sein Zeichenstil, dem Schöpfer Hergé den Namen verlieh: Ligne Claire.
Wer kennt ihn nicht? Tim, jener junge Mann mit der fliegenden roten Haartolle, Held des Abenteuer-Comics, Fossil der Comic-Geschichte, zeitlos wie sein Zeichenstil, dem Schöpfer Hergé den Namen verlieh: Ligne Claire.
Tim ist Reisender. Reporter in den seltensten Fällen. Abenteuerlustiger Detekiv so gut wie immer. Niemand, der ihn nicht kennt und bewundert, kein Gangster, der ihn nicht fürchtet. Probleme? Gibt es rund um den Globus viele, soziale wie politische. Aber keine, die Tim nicht lösen kann. In der Sowjetunion begegnet er der bolschewistischen Revolution, in Amerika dem Gangster Al Capone, in den Tibet entdeckt er den Yeti, in Mexiko den Sonnentempel der Inkas. Weitere Ziele: Großbritannien, China, Japan, der Balkan, Peru, die Schweiz, Ägypten, Arabien, Osteuropa und sogar der Mond, lange bevor der erste Mensch tatsächlich seinen Fuß darauf setzte.
An Tims Seite befindet sich stets Struppi, die Pudel-Terrier-Mischung, und natürlich der trink-, rauf- und fluchfeste Käpt’n Haddock, die sich in Wortspielen beflügelnden Herren Schulze und Schultze sowie der tolpatschige Professor Bienlein. Eine große Hilfe sind Tim allerdings nicht, stattdessen oft Grund allen Chaos'.
»Tim & Struppi« sind ein Klassiker der frankobelgischen Comics, auch wenn Klischees und Vorurteile der damaligen Zeit die ersten Geschichten prägten: »Im Lande der Sowjets«, »Tim im Kongo«, »Tim in Amerika« und »Die Zigarren des Pharaos«. Erst mit »Der blaue Lotus« beginnt Hergé viel Zeit für Recherchen über die geographischen, kulturellen, sozialen und politischen Hintergründe der Länder zu recherchieren, in denen seine Geschichten spielen.
Da Hergé verfügte, dass die Serie nach seinem Tod nicht weitergeführt werden dürfe, blieb es bei 24 Alben und dem unvollendeten »Tintin und die Alpha-Kunst«.
Hergé: Tim im Kongo (1930)
My history of bookshelf (39): »Colorado Saga« von James A. Michener
 Die letzten Monate habe ich fast ausnahmslos von den fantastischen Büchern erzählt, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe: viel Horror, noch mehr Stephen King. Daneben habe ich natürlich auch immer wieder Bücher anderer Autoren gelesen, und nicht wenige davon haben mich inspiriert, geprägt, begeistert. Weswegen sie bis heute Ehrenplätze in meinen Bücherregalen besitzen.
Die letzten Monate habe ich fast ausnahmslos von den fantastischen Büchern erzählt, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe: viel Horror, noch mehr Stephen King. Daneben habe ich natürlich auch immer wieder Bücher anderer Autoren gelesen, und nicht wenige davon haben mich inspiriert, geprägt, begeistert. Weswegen sie bis heute Ehrenplätze in meinen Bücherregalen besitzen.
Einer dieser Autoren ist James A. Michener.
Micheners Romane sind einerseits historische Wälzer, andererseits monumentale Chroniken. Der Einstieg in seine Geschichten ist zäh, schildert Michener doch jedesmal erst ausführlichst die tektonische Entstehung jener (meist nordamerikanischen) Landstriche - Colorado, Texas, Alaska, die Karibik, die Ostküste Amerikas - die Bucht.
Kaum tritt allerdings der Mensch in Erscheinung, macht es Michener richtig spannend. Anhand dem Beispiel einzelner Familien spürt er (nicht minder akribisch) über mehrere Jahrhunderte und Generationen hinweg bis heute all den Leuten nach, die diese Länder erobert und dabei ihren Stempel hinterlassen haben. Einige dieser Sagen sind sogar verfilmt worden. Noch gut erinnere ich mich an die mehrteilige Colorada-Saga mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle.
In all den Jahren habe ich keinen Autor erlebt, der vergleichbare Bücher schreibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Verlage heute noch viel Bereitschaft zeigen, solche Werke wie die von Michener zu veröffentlichen. Leider.
James A. Michener: Die Coloda-Saga (1974)
My history of bookshelf (38): »Wolf« von Joachim Körber
 Mitte der 90-er - ich befand mich immer noch auf meinem Horror-Trip - trat einen Job als Chefredakteur eines süddeutschen Stadtmagazins an. Für dessen Literaturseiten wollte ich mich in einem Beitrag mit unserer Begeisterung für phantastische Literatur und insbesondere mit unserer Faszination am Bösen auseinandersetzen. Per Zufall fand ich heraus, dass in unmittelbarer Nähe der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber lebte und arbeitete. Als ich ihn um ein Interview bat, lud er mich tatsächlich zu sich in die hochheiligen Hallen der Edition Phantasia ein.
Mitte der 90-er - ich befand mich immer noch auf meinem Horror-Trip - trat einen Job als Chefredakteur eines süddeutschen Stadtmagazins an. Für dessen Literaturseiten wollte ich mich in einem Beitrag mit unserer Begeisterung für phantastische Literatur und insbesondere mit unserer Faszination am Bösen auseinandersetzen. Per Zufall fand ich heraus, dass in unmittelbarer Nähe der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber lebte und arbeitete. Als ich ihn um ein Interview bat, lud er mich tatsächlich zu sich in die hochheiligen Hallen der Edition Phantasia ein.
Obwohl ich damals schon seit zehn Jahren als Journalist arbeitete und gefühlt hunderte Interviews geführt hatte, war ich auf der Fahrt nach Bellheim aufgeregt. Ich weiß, ich tat Körber damit Unrecht, aber ein Treffen mit ihm war für mich damals fast wie ein Begegnung mit Stephen King höchstpersönlich.
Zum Glück ließen wir den King of Horror schon bald hinter uns. Es wurde ein entspanntes, aufschlußreiches Gespräch über Bücher, über Phantastik, über Körbers Leidenschaft für gute Bücher und über seinen ambitionierten Verlag. Seitdem schätze ich ihn und sein Engagement sehr. Und was er mir damals außerdem verriet: Dass er unglaublich gerne selbst mal einen Roman schreiben wollte.
Ich freute mich sehr für ihn, als ihm dieser Wunsch 1998 erfüllt wurde: »Wolf« ist ein flotter, spannender Mystery-Roman, der auf jeder Seite die Stimme Stephen Kings atmet. Nicht falsch verstehen: Das ist keine Kritik, sondern ein großes Lob.
Joachim Körber: Wolf (1998)
My history of bookshelf (37): »Highway ins Dunkel« von Dean Koontz
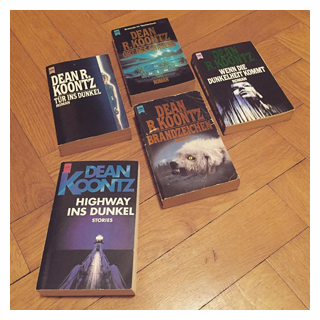 Im Zuge des großen Horrorbooms in den 80-ern und 90-ern kamen natürlich auch die Bücher von Dean Koontz (lange Zeit auch: Dean R. Koontz) zu uns. Ich habe eine Menge von ihm gelesen, insbesondere seine Horrorromane, zum Beispiel »Phantoms«, »Brandzeichen«, »In der Kälte der Nacht«, sogar die Short Story-Sammlung »Highway ins Dunkel« - viel ist davon leider nicht hängengeblieben.
Im Zuge des großen Horrorbooms in den 80-ern und 90-ern kamen natürlich auch die Bücher von Dean Koontz (lange Zeit auch: Dean R. Koontz) zu uns. Ich habe eine Menge von ihm gelesen, insbesondere seine Horrorromane, zum Beispiel »Phantoms«, »Brandzeichen«, »In der Kälte der Nacht«, sogar die Short Story-Sammlung »Highway ins Dunkel« - viel ist davon leider nicht hängengeblieben.
Woran ich mich allerdings sehr gut erinnere: Dass mich bei der Lektüre ständig das Gefühl beschlich, dass Koontz' Geschichten von anderen Autoren zuvor schon erzählt worden waren, und dies obendrein noch viel besser. Koontz' Ideen, die Ausarbeitung, die Sprache, das war nichts Halbes wie bei einem John Saul, aber bei weitem auch nichts Ganzes wie bei einem Stephen King.
Bei irgendeinem meiner vielen Umzüge packte mich schließlich der Frust und ich tat das, was ich nur ganz selten mache: Ich verkaufte Bücher. Und zwar nahezu alle Koontz-Werke, die ich gesammelt hatte. Geblieben sind mir diese fünf Exemplare. Ob ich je nochmal reinlese? Vermutlich nicht.
Dean Koontz: Highway ins Dunkel (1995)
My history of bookshelf (36): »Jahreszeiten« von Stephen King
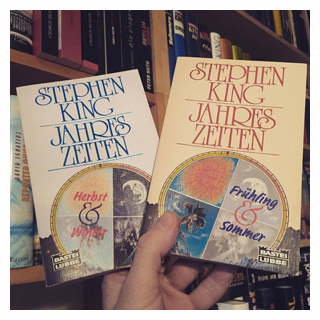 Nicht nur ein King der (Horror)-Romane und Kurzgeschichten – auch auf Novellen versteht sich Stephen King höchstmeisterlich. Ein Beweis? Die »Jahreszeiten« mit vier Erzählungen.
Nicht nur ein King der (Horror)-Romane und Kurzgeschichten – auch auf Novellen versteht sich Stephen King höchstmeisterlich. Ein Beweis? Die »Jahreszeiten« mit vier Erzählungen.
Das Außergewöhnliche daran: Keinerlei Horror, Spukhäuser oder Vampire, übersinnlichen oder andere Erscheinungen. Einzig »Atemtechnik« passt durch ihre Idee (eine schwangere Frau, die bei einem Unfall enthauptet wird und trotzdem ihr Kind zur Welt bringt) noch am ehesten in das King-Klischee.
»Der Musterschüler« dagegen erzählt vom dreizehnjährigen Todd, dessen Hobby Nazi-Greuel sind. Dabei kommt er einen untergetauchten Auschwitz-Kommandanten auf die Spur, den er foran zwingt, von den begangenen Grausamkeiten zu erzählen. Todd ist derart fasziniert, dass er selbst zu morden beginnt. »Vielleicht besteht ein Teil unseres Grauens und Entsetzens darin«, sagt King, »dass wir insgeheim wissen, dass wir unter den richtigen – oder falschen – Umständen selbst bereit wären, solche Lager zu bauen, und das Personal dafür zu stellen.«
Über »Die Leiche« muss ich nicht mehr viele Worte verlieren: Vier Freunde, die sich im Sommer 1960 auf die Suche nach der Leiche eines Jungen machen, der von einem Zug überrollt worden ist. Der Reiz dieser Story liegt in unseren Erinnerungen an die Jugendzeit – Jugendfreundschaften, die Wehmütigkeit über das Erwachsenwerden, die daraus resultierenden Konflikte, der Verlust der Freunde. Großartig fürs Kino verfilmt.
Was erst recht für »Pin Up« gilt: Obwohl unschuldig, wird Bankier Andy Dufresne für den Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Im Gefängnis erwartet ihn die Hölle, doch er gibt nicht auf. Mit einem Poster von Rita Hayworth tarnt er in seiner Zelle einen Tunnel, den er sich über zwanzig bittere Jahre in die Freiheit gräbt. Kings Credo: »Ob schuldig oder unschuldig – du darfst die Hoffnung nie aufgeben.«
Stephen King: Jahreszeiten (1982)
My history of bookshelf (35): »Skeleton Crew« von Stephen King
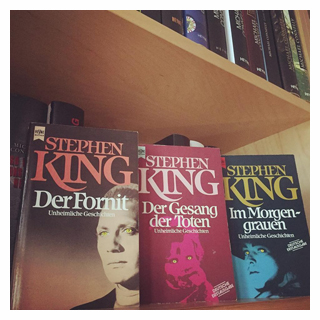 Ich erwähnte es, nur wenige Autoren verstehen ihr Short Story-Handwerk so gut wie Stephen King. Weshalb er auch einer der wenigen ist, die nach wie vor Kurzgeschichten schreiben, die dann in schöner Regelmäßigkeit in Sammelbänden veröffentlicht werden. Nachdem ich mich unlängst bereits seiner ersten Anthologie »Nachtschicht« ausführlich gewidmet habe, komme ich jetzt - zwangläufig - zur »Skeleton Crew«, deren 22 Short Stories hierzulande seinerzeit in drei Bänden veröffentlicht wurden: »Der Fornit«, »Der Gesang der Toten« und »Im Morgengrauen«. Erst 1996 folgte eine Neuübersetzung aller Erzählungen in einem Band: »Blut«.
Ich erwähnte es, nur wenige Autoren verstehen ihr Short Story-Handwerk so gut wie Stephen King. Weshalb er auch einer der wenigen ist, die nach wie vor Kurzgeschichten schreiben, die dann in schöner Regelmäßigkeit in Sammelbänden veröffentlicht werden. Nachdem ich mich unlängst bereits seiner ersten Anthologie »Nachtschicht« ausführlich gewidmet habe, komme ich jetzt - zwangläufig - zur »Skeleton Crew«, deren 22 Short Stories hierzulande seinerzeit in drei Bänden veröffentlicht wurden: »Der Fornit«, »Der Gesang der Toten« und »Im Morgengrauen«. Erst 1996 folgte eine Neuübersetzung aller Erzählungen in einem Band: »Blut«.
In Amerika gibt es darüber hinaus eine auf 1052 numerierte und signierte Exemplare veröffentlichte Ausgabe von »Skeleton Crew«, die obendrein die Kurzgeschichte »Die Offenbarungen der 'Becka Paulson« enthält, die später in überarbeiteter, endgültiger Form in den Roman »Tommyknockers - Das Monstrum« einfloß.
Stephen King: Skeleton Crew (1985)
My history of bookshelf (34): »Nachtschicht« von Stephen King
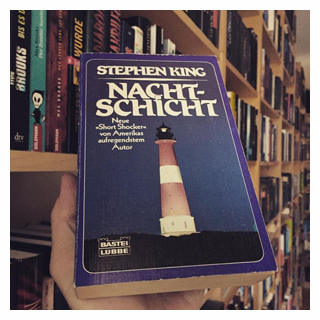 Soviel ist sicher, Kurzgeschichten sind hierzulande ein brotloser Job. Es gibt immer mal wieder Anthologien, auch Short Story-Bände einzelner Autoren, aber wirklich verkaufen tun sie sich nicht. Eine gute Geschichte muss Romanlänge haben.
Soviel ist sicher, Kurzgeschichten sind hierzulande ein brotloser Job. Es gibt immer mal wieder Anthologien, auch Short Story-Bände einzelner Autoren, aber wirklich verkaufen tun sie sich nicht. Eine gute Geschichte muss Romanlänge haben.
Doch keine Regel ohne Ausnahme: Als Stephen King mit »Carrie«, »Brennen muss Salem« und »Shining« seinen literarischen Durchbruch erlebte, und dies in einem Genre und mit einem Ausmaß, das wohl niemand erwartet hätte, werden sogar seine Kurzgeschichten in Sammelbänden verlegt - und verkaufen sich wie geschnitten Brot. Einfach weil der Name King auf dem Cover steht. Was so manche zu der Annahme verleitet, dass wohl selbst Kings Einkaufsliste ein Bestseller werden würde. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass King auch das Short Story-Handwerk wie kaum ein anderer großartig beherrscht.
»Nachtschicht«, die erste seiner vielen Kurzgeschichtensammlungen, enhält seiner 20 Stories, die allesamt vor seinem Erfolg entstanden sind, viele davon erschienen im Herrenmagazin »Cavalier« für 250 bis 300 Dollar das Stück. Weitere der Geschichten wurden in besser zahlenden Magazinen wie »Gallery«, »Cosmopolitan« und »Penthouse« abgedruckt. Auf diese Weise brachte King seine Familie über die Runden.
Ein Großteil der Geschichten ist reine Unterhaltung mit einer prickelnden Spur Horror, Schrecken oder Grauen, wie zum »Spätschicht« oder »Der Rasenmäher-Mann« (der rein gar nichts mit der grottigen Filmadaption zu kriegen hat). Andere dagegen weisen eindeutig tiefere Stärken auf, nicht zuletzt, weil sie Querverweise auf andere Werken von King enthalten. »Briefe aus Jerusalem« spielt beispielsweise vor den Ereignissen von »Brennen muss Salem«. »Einen auf den Weg« spielt nach den Ereignissen von »Brennen muss Salem«. »Nächtliche Brandung« wiederum ist eine Erzählung, die eindeutig in der postapoklyptischen Welt vom Roman »Das letzte Gefecht« angesiedelt ist.
Stephen King: Nachtschicht (1978)
My history of bookshelf (33): »The Green Mile« von Stephen King
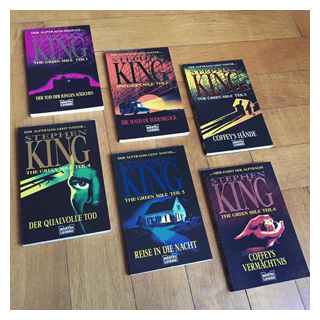 Wenn wir schon über Stephen King reden, dann natürlich auch über »The Green Mile«, ein weiteres, vielleicht sogar das spannendste Experiment, das King im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere wagte. Dabei war die Idee nicht einmal neu: Charles Dickens hat viele seiner Romane als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht, entweder als Beilage in Zeitschriften oder als eigene Ausgabe, so genannte »Chapbooks«.
Wenn wir schon über Stephen King reden, dann natürlich auch über »The Green Mile«, ein weiteres, vielleicht sogar das spannendste Experiment, das King im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere wagte. Dabei war die Idee nicht einmal neu: Charles Dickens hat viele seiner Romane als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht, entweder als Beilage in Zeitschriften oder als eigene Ausgabe, so genannte »Chapbooks«.
Diese Fortsetzungsromane waren enorm beliebt, was King, selbst erklärter Dickens-Anhänger, 1996 zu eigenen Chapbooks inspirierte: »Bei einer Geschichte, die in Fortsetzungen veröffentlicht wird, gewinnt der Schriftsteller eine Überlegenheit über den Leser, die er sonst nicht genießen kann: einfach gesagt, sie können nicht vorausblättern und sehen, wie die Sache ausgeht.«
Von März bis August veröffentlichte er sechs 128seitigen Folgen weltweit gleichzeitig – und allein in Deutschland in einer Rekordauflage von 700.000 Exemplaren.
»The Green Mile«, übrigens einer der wenigen Romane, der keinerlei Querverweise auf andere King-Werke enthält, erzählt über das Leben und über den allgegenwärtigen Tod im Todestrakt eines Gefängnisses. Wie erleben die Verurteilte ihre letzten Tage? Welche Gefühle haben sie, wenn sie überhaupt welche haben? Und wie leben die Gefängnisaufseher mit den Verbrechern, Mördern, Kriminellen, die sie schon bald auf ihrem letzten Weg über die »Green Mile« zum elektrischen Stuhl begleiten müssen? Und was bedeutet es, einen Menschen sozusagen legal zu töten? Was geht in einem Menschen vor, der den Knopf betätigt und somit gleiches mit gleichem vergeltet? Die zentralen Fragen bilden den Rahmen nicht nur für eine spannende Fortsetzungsgeschichte über Menschen, Morde und Mysterien, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Todesstrafe. Unbedingt empfehlenswert!
Stephen King: The Green Mile (1996)
My history of bookshelf (32): »Das Monstrum«, »In einer kleinen Stadt« & »Stark« von Stephen King
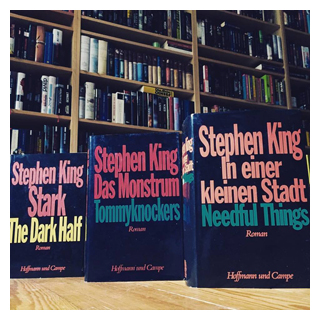 Vordergründig geht's in allen drei Romanen um Bösewichter, Monster, Aliens oder um den Teufel. Tatsächlich aber handeln sie von menschlicher Psyche, deren Veränderung. Oder mit Kings Worten: »wie die Menschen funktionieren«, vor allem wenn sie habgierig sind.
Vordergründig geht's in allen drei Romanen um Bösewichter, Monster, Aliens oder um den Teufel. Tatsächlich aber handeln sie von menschlicher Psyche, deren Veränderung. Oder mit Kings Worten: »wie die Menschen funktionieren«, vor allem wenn sie habgierig sind.
In »Das Monstrum« stolpert die Western-Schriftstellerin Roberta Anderson beim Waldspaziergang über ein Metallstück, gräbt es aus und legt die außerirdischen Tommyknockers frei, eine gestaltlose Macht, die mit Hilfe der Menschen ein kollektives Bewusstsein erschafft, um mit gebündelter Geisteskraft das Raumschiff ans Laufen zu bekommen. Gleichzeitig haben die an das Alien-Netzwerk angeschlossenen Menschen für die kurze Zeit ihres Lebens Zugriff auf ein jahrtausendaltes Wissen und können Übermenschliches leisten.
Ebensolches ermöglicht auch der geheimnisvolle Fremde, der »In einer kleinen Stadt« den Laden »Needful Things« eröffnet. Hier finden Kunden genau das, was sie sich schon immer am sehnlichsten gewünscht haben. Natürlich hat die Erfüllung dieser Herzenswünsche ihren Preis, und da es sich bei Leland Gaunt um den Leibhaftigen persönlich handelt, ist klar, dass er an Geld nicht sonderlich interessiert ist. Die Habgier seiner Kunden führt zum Verlust ihrer seelischen Unschuld.
In gewisser Weise trifft das auch auf den Schriftsteller Thad Beaumont zu, der erfolglose Literatur schreibt, während er als George »Stark« mit blutrünstige Bestseller hinlegt. Bis sein Pseudonym enthüllt und er erpresst wird. Beaumont, ohnehin der Horrorbücher überdrüssig, lässt seine dunkle Hälfte werbewirksam feierlich beerdigen. Doch so einfach wird er sein Alter Ego nicht los - das Scheingrab öffnet sich, Menschen werden ermordet, die in die Enthüllung des Pseudonyms verwickelt sind. Der auferstandene Stark zwingt Beaumont, ihm durch das Schreiben eines neuen Stark-Romans wieder Leben einzuhauchen. Gibt es Stark tatsächlich? Oder ist es nur der tiefe Wunsch Beaumonts, auch weiterhin Erfolg zu haben?
Stephen King: Das Monstrum - Tommyknockers (1987), Stark - The Dark Half (1989), In einer kleinen Stadt - Needful Things (1991)
My history of bookshelf (31): »Desperation« von Stephen King/»Regular« von Richard Bachman
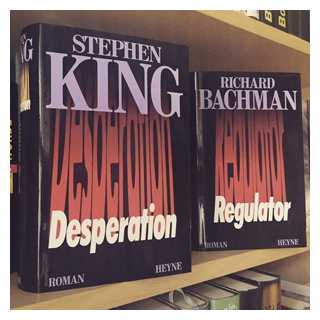 Wer meine Thriller kennt, der weiß: Ich liebe das raffinierte Spiel mit den Handlungsebenen. Leine Ahnung, woher diese Vorliebe zur Verquickung unterschiedlichster Perspektiven kommt. Wohl aber weiß ich, dass ich dies zum allerersten Mal ganz bewusst bei Stephen Kings Doppelschlag »Desperation« und »Regulator« (veröffentlicht unter Richard Bachman) wahrgenommen habe.
Wer meine Thriller kennt, der weiß: Ich liebe das raffinierte Spiel mit den Handlungsebenen. Leine Ahnung, woher diese Vorliebe zur Verquickung unterschiedlichster Perspektiven kommt. Wohl aber weiß ich, dass ich dies zum allerersten Mal ganz bewusst bei Stephen Kings Doppelschlag »Desperation« und »Regulator« (veröffentlicht unter Richard Bachman) wahrgenommen habe.
Beide Romane erzählen von TAK, ein dem Lovecraftschen Kosmos entlehntes, übernatürliches Wesen. Es ist seit Jahrtausenden im rostrotschimmernden »Brunnen der Welten« in der alten Chinamina des Bergbaukaffs Desperation (Nevada) gefangen, bei dem es sich offensichtlich um einen Zugang in eine andere Welt handelt. Höchstwahrscheinlich die von Roland Deschain, dem Revolvermann aus dem Zyklus »Der dunkle Turm«.
Während »Desperation« aber den gewohnten King-Pfaden folgt, ist »Regulator« der unkonventionelle und originellere der beiden Romane, zynischer und ungestümer, wie man King unter seinem Pseudonym bereits in den 80-ern kennengelernt hat. Der Aufbau des Romans ist von einer ungewohnten Wildheit: Er setzt sich aus Abschnitten mit wechselnden Zeitformen, Tagebucheinträgen, Briefen und Skizzen zusammen, die alles in allem einen Handlungszeitraum von nur zwei Stunden beschreiben. Das für King wohl Untypischste dürfte die Handlung sein, die zwar ebenfalls vpm TAK ausgeht, das in »Desperation« befreit wird, auch ein Großteil der aus »Desperation« bekannten Helden mitspielen, aber alle eine andere Funktion erfüllen, sodass die Vermutung naheliegt, dass es sich in "Regulator" um eine weitere Parallelwelt handelt.
Stephen King: Desperation, Richard Bachman: Regulator (1996)
My history of bookshelf (30): »Das Attentat« von Stephen King
 Wie viele andere Romane Kings handelt auch »Das Attentat« vom typischen Mittelschicht-Amerikaner, der sich nichts hat zu Schulde kommen lassen und trotzdem vom Schicksal schwer bestraft wird. Nicht umsonst rätselt die Freundin von Johnny Smith, der »Es tut mir leid, dass es passiert ist. Ich versuchte dahinter zu kommen, warum ... oder wie man es hätte anders machen können ...« Sie weiß keine Antwort. Natürlich nicht. Kings Credo ist schließlich: »Guten Menschen stossen böse Dinge zu, weil das Leben nun einmal so ist.«
Wie viele andere Romane Kings handelt auch »Das Attentat« vom typischen Mittelschicht-Amerikaner, der sich nichts hat zu Schulde kommen lassen und trotzdem vom Schicksal schwer bestraft wird. Nicht umsonst rätselt die Freundin von Johnny Smith, der »Es tut mir leid, dass es passiert ist. Ich versuchte dahinter zu kommen, warum ... oder wie man es hätte anders machen können ...« Sie weiß keine Antwort. Natürlich nicht. Kings Credo ist schließlich: »Guten Menschen stossen böse Dinge zu, weil das Leben nun einmal so ist.«
Aus diesem Grund erleben wir, wie der schlacksige, dreiundzwanzigjährige Johnny Smith nach einem Autounfall für fünf Jahre in Koma fällt. Als er erwacht, hat sich sein Leben geändert: Nicht nur, dass seine Freundin mit einem anderen Mann abgehauen ist. Auch seine Fähigkeit, in die Vergangenheit und Zukunft gucken zu können, ist vollends ausgeprägt. Er braucht nur noch einen Menschen berühren, um dessen Vergangenheit, gegenwärtige Lebensumstände und Zukunft vor sich zu sehen.
Als er die Hand von Greg Stillson schüttelt, einem mit Wahnsinn gesegneten Politiker, sieht Johnny, dass dieser als späterer US-Präsident einen Atomkrieg auslösen wird (kaum zu glauben, dass der Roman schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat!). Johnny steht vor der moralischen Qual der Wahl: Mit einem schlechten Gewissen wegschauen und den atomaren Gau in Kauf nehmen – oder reinen Gewissens die Katastrophe verhindern, aber sein Gewissen mit einem Mord belasten? Die Entscheidung fällt: Johnny plant ein Attentat.
Furios ist das Finale, in dem er auf einer Wahlveranstaltung das Gewehr auf Stillson richtet und dieser vor laufenden Kameras ein Kind als Schutzschild missbraucht. Stillson steht – ohne von einer Kugel getroffen - vor dem politischen Aus, und Johnny stirbt im Kugelhagel der Sicherheitskräfte. Ungerechte Welt, meint der Leser, doch Johnny wird auch gerettet, nämlich von dem schmerzhaften Leidensweg einer Krankheit: Ein Gehirntumor. Also doch eine gerechte Welt?
Stephen King: Dead Zone - Das Attentat (1979)
My history of bookshelf (29): »Sommer der Nacht« von Dan Simmons
 Selten einen Genreautor gelesen, der sich so wenig um Schubladen schert wie Dan Simmons. Meine Begeisterung für den US-Autor begann einst, natürlich, mit seinen unheimlichen Geschichten: sein höchst originelles Debüt »Göttin des Todes« (Song of Kali), »Styx«, »Kinder der Nacht« und »Kraft des Bösen«, ein Ziegelstein von Vampirroman. Sein »Sommer der Nacht« gilt unter Fans »als der beste Stephen King-Roman, den King nicht geschrieben hat«. Darüber lässt sich herzlich streiten, aber ja, der Roman über eine Gruppe Jugendlicher, die sich in ihren Sommerferien irgendwann in den 60-ern dem Schrecken ihrer verschlafenen Kleinstadt stellen müssen, hat was von »Es«.
Selten einen Genreautor gelesen, der sich so wenig um Schubladen schert wie Dan Simmons. Meine Begeisterung für den US-Autor begann einst, natürlich, mit seinen unheimlichen Geschichten: sein höchst originelles Debüt »Göttin des Todes« (Song of Kali), »Styx«, »Kinder der Nacht« und »Kraft des Bösen«, ein Ziegelstein von Vampirroman. Sein »Sommer der Nacht« gilt unter Fans »als der beste Stephen King-Roman, den King nicht geschrieben hat«. Darüber lässt sich herzlich streiten, aber ja, der Roman über eine Gruppe Jugendlicher, die sich in ihren Sommerferien irgendwann in den 60-ern dem Schrecken ihrer verschlafenen Kleinstadt stellen müssen, hat was von »Es«.
Inzwischen hat Simmons das Horrorfach verlassen, sich stattdessen den historischen Thrillern zugewandt, und das mit ebensolcher Wucht: In »Terror« zeichnet er Sir John Franklins Suche nach der Nordwestpassage nach, bei der einst 128 Seeleute spurlos verschwanden. Mit »Drood« widmet er sich dem letzten, unvollendeten Roman Charles Dickens. In »Der Berg« geht er dem Verschwinden der beiden Bergsteiger George Mallory und Andrew Irvine am Mount Everest auf den Grund. Und statt »Fiesta in Havanna« macht Ernest Hemingway im Zweiten Weltkrieg Jagd auf U-Boote vor der Küste Kubas. Klingt skurril? Ist es nicht, sondern historisch verbürgt und von Simmons mit ungeheurer Akribie aufgearbeitet.
Glaubt man Fans und Kritikern, geht er mit ebensolcher Hingabe auch bei seinen Science Fiction-Romanen vor: die »Hyperion-Gesänge«, »Endymion«, »Olympos«, »Helix« und »Ilium«. Da muss ich aber passen, zu SF fand ich nie einen besonderen Draht ...
Dan Simmons: Sommer der Nacht (1991)
My history of bookshelf (28): »Die Besucher« von Whitley Strieber
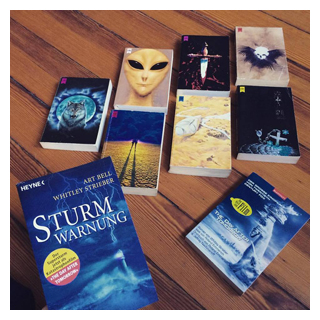 Es gab eine Zeit, da haben sich die Verlage noch etwas getraut. Die Bücher von Whitley Strieber zum Beispiel, die im Zuge des Horrorbooms in den 80-ern auch nach Deutschland schwappten, sind allesamt ohne Covertext erschienen. Kein Autorenname, kein Buchtitel, nur ein Titelbild. Absolute Hingucker, und für einen Büchernerd wie mich unbedingte Sammelobjekte.
Die Geschichten selber: »Wolfsbrut«, »Bestie«, »Unheiliges Feuer«, eine Mischung aus Horror und Thriller, nicht unbedingt aus der Masse herausragend, aber durchaus lesenswert (und einige sogar verfilmt). Aber besser als das Horroreinerlei aus der Feder von John Saul und James Herbert, definitiv.
Es gab eine Zeit, da haben sich die Verlage noch etwas getraut. Die Bücher von Whitley Strieber zum Beispiel, die im Zuge des Horrorbooms in den 80-ern auch nach Deutschland schwappten, sind allesamt ohne Covertext erschienen. Kein Autorenname, kein Buchtitel, nur ein Titelbild. Absolute Hingucker, und für einen Büchernerd wie mich unbedingte Sammelobjekte.
Die Geschichten selber: »Wolfsbrut«, »Bestie«, »Unheiliges Feuer«, eine Mischung aus Horror und Thriller, nicht unbedingt aus der Masse herausragend, aber durchaus lesenswert (und einige sogar verfilmt). Aber besser als das Horroreinerlei aus der Feder von John Saul und James Herbert, definitiv.
Aber so richtig habe ich mich mit Strieber erst beschäftigt, als ich »Die Besucher« (das Buch mit dem Alien-Cover) las, angeblich ein autobiografischer Roman, in dem Strieber davon erzählt, wie er aus seiner Blockhütte in New York von Außerirdischen entführt wurde, um anschließend medizinische Experimente an sich erdulden zu müssen: »Wenn ihr diese unglaubliche Geschichte lest", schreibt Strieber im Vorwort, "seid nicht zu skeptisch: auch in eurer Vergangenheit kann es eine verlorene Stunde, eine seltsame Erinnerung geben, die zeigt, dass ihr das gleiche erlebt habt. Dieses Buch ist die Schilderung einer neuen Beziehung zum Unbekannten. Statt die Dunkelheit zu meiden, sollten wir mit offenen Sinnen direkt hineinblicken. Und wenn wir das tun, ändert sich das Unbekannte. Schreckliche Dinge werden verständlich, und eine Wahrheit drängt sich auf: eine rätselhafte Form menschlichen Geistes blitzt aus dem Dunkeln zurück.«
2004 hat Strieber die Vorlage zu Roland Emmerichs »The Day After Tomorrow« (sowie das Buch zum Film) geschrieben.
Whitley Strieber: Die Besucher (1987)
My history of bookshelf (27): »48« von James Herbert
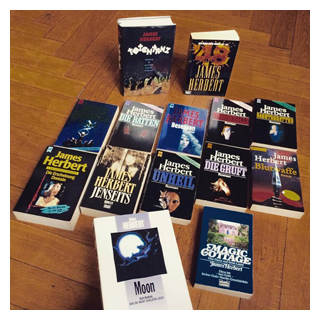 Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich über James Herbert gestolpert bin im Zuge meiner Horroreurphorie, die Stephen King seinerzeit bei mir weckte. In der Folge habe ich alles gekauft und gelesen, was ansatzweise Grusel versprach, und dazu gehörte eben auch Herbert. So gelangten nach und nach fast alle Bücher von ihm in meinen Besitz, »Totentanz«, »Creed«, »Magic Cottage«, »Die Gruft«, aber ich muss gestehen: Hängengeblieben ist von den Geschichten bei mir fast gar nichts. Woran das liegt? Wikipedia schreibt: »James Herbert war bekannt für seine einfachen, jedoch fesselnden Romane.«
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich über James Herbert gestolpert bin im Zuge meiner Horroreurphorie, die Stephen King seinerzeit bei mir weckte. In der Folge habe ich alles gekauft und gelesen, was ansatzweise Grusel versprach, und dazu gehörte eben auch Herbert. So gelangten nach und nach fast alle Bücher von ihm in meinen Besitz, »Totentanz«, »Creed«, »Magic Cottage«, »Die Gruft«, aber ich muss gestehen: Hängengeblieben ist von den Geschichten bei mir fast gar nichts. Woran das liegt? Wikipedia schreibt: »James Herbert war bekannt für seine einfachen, jedoch fesselnden Romane.«
Einzig an seinen Roman »48« kann ich mich erinnern, und auch nur deshalb, weil mich dieser postapoklyptische Thriller derart langweilte, dass ich das Interesse an Herbert verlor.
So schleppe ich seine Bücher seit Jahrzehnten bei jedem Umzug wohl eher aus nostalgischen Gründen mit. Und weil ich mich von Büchern einfach nicht trennen kann.
James Herbert: 48 (1996)
My history of bookshelf (26): »Geisterstunde« von Peter Straub
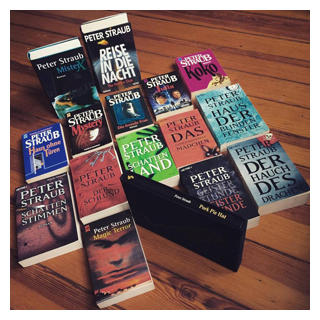 Als Horror in den 80-ern - dank Stephen King - einen Boom erlebte, wurde auch der US-Autor Peter Straub hierzulande in schöner Regelmäßigkeit verlegt. Allerdings erreichte er nie jene Popularität, die seinen Kollegen wie John Saul, James Herbert oder Dean Koontz vergönnt war. Obwohl seine Romane sich inhaltlich kaum von ihren unterschieden - auch in Straubs Werken sind es die dunklen Schatten eines meist weit zurückliegenden Ereignisses, die die Protagonisten unweigerlich einholen -, gestaltete er seine Geschichten häufig nicht ganz so massenkompatibel aus.
Als Horror in den 80-ern - dank Stephen King - einen Boom erlebte, wurde auch der US-Autor Peter Straub hierzulande in schöner Regelmäßigkeit verlegt. Allerdings erreichte er nie jene Popularität, die seinen Kollegen wie John Saul, James Herbert oder Dean Koontz vergönnt war. Obwohl seine Romane sich inhaltlich kaum von ihren unterschieden - auch in Straubs Werken sind es die dunklen Schatten eines meist weit zurückliegenden Ereignisses, die die Protagonisten unweigerlich einholen -, gestaltete er seine Geschichten häufig nicht ganz so massenkompatibel aus.
Ich hatte immer den Eindruck, dass Straubs Romane wie »Geisterstunde«, »Koko«, »Schattenland« oder »Der Hauch des Drachen« eher nur Geheimtipps waren für Horrorfreunde, die gerne auch ein bisschen mehr von einer guten Geschichte erwarten als nur Psycho, Grauen, Horror und viel Blut.
Entdeckt habe ich Straub, wie vermutlich die meisten, natürlich, durch »Der Talisman«, den er gemeinsam mit King verfasste.
Peter Straub: Geisterstunde (1979)
My history of bookshelf (25): »Der Talisman« von Stephen King & Peter Straub
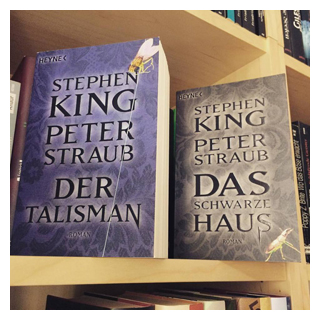 Der zwölfjährige Jack reist seit dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter Lily Sawyer umher. Lily ist eine abgehalfterte Schauspielerin, bekannt aus dem Film »Blaze« (übrigens ein King-Roman, der lange Zeit unveröffentlicht in der Schublade lag, bevor er 2007 tatsächlich erschien). Außerdem ist sie an Krebs erkrankt. Doch Jack kann sie mithilfe des geheimnisvollen Talismans retten. Dazu muss er in die »Region« wechseln, eine mittelalterliche, aber gar nicht märchenhafte Welt, in der die »Twinners« der Menschen leben, ihre Spiegelbilder. In dieser Welt ist Jacks Mutter die Königin Laura DeLoessian, der ihre Feinde zusetzen. Einzig Jack hat keinen Twinner, der wurde vom bösen Morgan von Orris ermordet. Dieser ist der Twinner von Morgan Sloat, der Jacks Vater auf dem Gewissen hat.
Der zwölfjährige Jack reist seit dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter Lily Sawyer umher. Lily ist eine abgehalfterte Schauspielerin, bekannt aus dem Film »Blaze« (übrigens ein King-Roman, der lange Zeit unveröffentlicht in der Schublade lag, bevor er 2007 tatsächlich erschien). Außerdem ist sie an Krebs erkrankt. Doch Jack kann sie mithilfe des geheimnisvollen Talismans retten. Dazu muss er in die »Region« wechseln, eine mittelalterliche, aber gar nicht märchenhafte Welt, in der die »Twinners« der Menschen leben, ihre Spiegelbilder. In dieser Welt ist Jacks Mutter die Königin Laura DeLoessian, der ihre Feinde zusetzen. Einzig Jack hat keinen Twinner, der wurde vom bösen Morgan von Orris ermordet. Dieser ist der Twinner von Morgan Sloat, der Jacks Vater auf dem Gewissen hat.
100 Jahre nach Tom Sawyer, im September 1981, bricht also dessen Namensvetter Jack zu seiner Reise auf. Er reist durch zwei Welten, die in einer Wechselwirkung zueinanderstehen: Ein kleiner, sechswöchiger Krieg in der »Region« ist Auslöser für den zweiten Weltkrieg bei uns. Und der Krebs von Lily bedeutet Krankheit für die Königin der »Region«.
»Der Talisman« schildert Kings Grundthema (das Erwachsenwerden in einer Welt, deren Realität zunehmend aus den Fugen gerät) vor einem Hintergrund gesellschaftlicher Verelendung und zunehmender Umweltverschmutzung. »So gesehen«, erklärt der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber, »ist der Roman eine weitere Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Traum, der zum Alptraum geworden ist.«
Außerdem ist er die erste Kooperation Kings mit einem anderen Autor (der mit »Das schwarze Haus« 2001 eine Fortsetzung folgte), seinem ebenso erfolgreichen Horror-Kollegen Peter Straub. Zu ihm nächste Woche mehr.
Stephen King/Peter Straub: Der Talisman (1984)
My history of bookshelf (24): »Die Augen des Drachen« von Stephen King
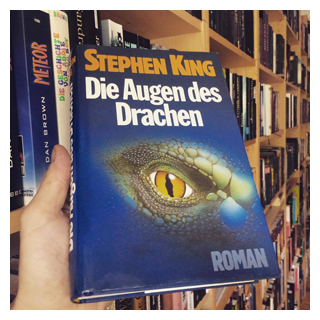 »Der dunkle Turm«, »Das letzte Gefecht« - da darf »Die Augen des Drachen« ebenso wenig fehlen. Einer der wenigen Fantasy-Romane, die ich gelesen habe.
»Der dunkle Turm«, »Das letzte Gefecht« - da darf »Die Augen des Drachen« ebenso wenig fehlen. Einer der wenigen Fantasy-Romane, die ich gelesen habe.
Im Königreich Delain, das in einer Welt liegt, die der Mittwelt aus »Der dunkle Turm« nicht unähnlich ist, herrscht König Roland, allerdings ist er alt und schwach. Sein Nachfolger soll sein ältester Sohn Peter werden, strahlend, kräftig, stattlich und intelligent. Unglücklicherweise gibt es noch den Hofzauberer (Randall) Flagg (ja genau, DER Randall Flagg aus »Der dunkle Turm« und »Das letzte Gefecht«), der lieber Rolands jüngeren Sohn Thomas, dick, pickelig, linkischer Nasebohrer, auf den Thron hieven möchte. Denn Flagg, das wissen geneigte King-LeserInnen, strebt die endgültige Vernichtung allen Lebens und das Chaos an. Tatsächlich gelingt ihm die Intrige, König Roland wird ermordet, sein Sohn Peter muss dafür ins Gefängnis, Bruder Thomas beginnt – unter Flaggs Einfluss – eine Schreckensherrschaft.
Natürlich gelingt Peter die Flucht und schließlich ein Sieg über Flagg, aber die Geschichte geht weiter. Denn von ihrem märchenhaften Charakter abgesehen, besitzen vor allem die vielen Querweise auf andere King-Werke ihren besonderen Reiz. Während sich in deren Geschichten oftmals Hinweise auf »Die Augen des Drachen« finden lassen.
Der vielleicht wichtigste Hinweis: In »Drei«, dem zweiten Dunkler-Turm-Band, erinnert sich der Revolvermann Roland Deschain in einer jähen Vision an Thomas aus Delain und dessen Kampf gegen den Zauberer Randall Flagg. Ist dieser Dunkler-Turm-Roland etwa der Roland aus Delain?
Stephen King: Die Augen des Drachen (1983)
My history of bookshelf (23): »Das letzte Gefecht« von Stephen King
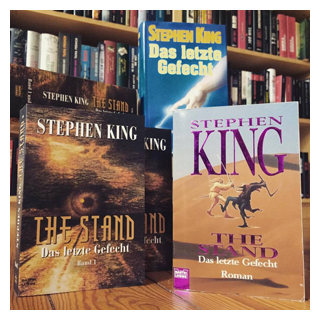 Wer (wie ich letzte Woche) über »Der dunkle Turm« spricht, der darf natürlich nicht den ebenso opulenten, großartigen Roman »Das letzte Gefecht« vergessen. Denn die Welt, in die der Revolvermann Roland Deschain und seine Freunde auf Suche nach dem dunklen Turm gelangen, wurde 1986 von der in geheimen Militärlabors gezüchteten Supergrippe Captain Trips heimgesucht, offenkundig die Welt aus »Das letzte Gefecht«.
Wer (wie ich letzte Woche) über »Der dunkle Turm« spricht, der darf natürlich nicht den ebenso opulenten, großartigen Roman »Das letzte Gefecht« vergessen. Denn die Welt, in die der Revolvermann Roland Deschain und seine Freunde auf Suche nach dem dunklen Turm gelangen, wurde 1986 von der in geheimen Militärlabors gezüchteten Supergrippe Captain Trips heimgesucht, offenkundig die Welt aus »Das letzte Gefecht«.
In »Das letzte Gefecht« (übrigens eine Fortführung der Kurzgeschichte »Nächtliche Brandung«, erschienen in der Storysammlung »Nachtschicht«) werden die dank der angeborenen Immunität Überlebenden von Träumen entweder zum (aus »Der dunkle Turm« wohlbekannten) »dunklen Mann« Randall Flagg nach Las Vegas geführt, oder zur 108jährigen Mutter »Abagail« nach Boulder, Colorado. Im Folgenden schildert Stephen King den packenden, beschwerlichen,spannenden Weg, den die unterschiedlichsten Menschen auf sich nehmen, um ihr Ziel zu erreichen.
Obwohl ein Fantasy-Epos, ist auch »Das letzte Gefecht« ein bis heute aktueller Thriller: »›Das letzte Gefecht‹«, erklärt King-Biograph Georg Beahm, »ist eine Parabel auf unsere Zeit. Wir haben Spielzeuge und Gerätschaften erschaffen, die wir nicht verstehen, und technologische Katastrophen, die wir vielleicht nicht kontrollieren können.«
1978 erschien die erste, um 400 Seiten gekürzte Fassung von »Das letzte Gefecht«, 1990 eine Neufassung mit überarbeitetem, offenem Ende.
Stephen King: Das letzte Gefecht (1978/1990)
My history of bookshelf (22): »Der dunkle Turm« von Stephen King
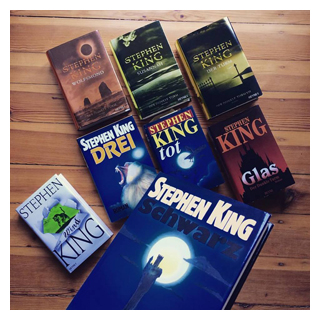 Ich bin kein Fantasy-Typ, kann gar nichts mit Drachen, Zwergen, Orks und Elfen anfangen. Damit kann mich jagen. Habe deshalb bis heute nicht einmal »Der Herr der Ringe« gelesen.
Ich bin kein Fantasy-Typ, kann gar nichts mit Drachen, Zwergen, Orks und Elfen anfangen. Damit kann mich jagen. Habe deshalb bis heute nicht einmal »Der Herr der Ringe« gelesen.
Es hat deshalb lange dauert, bis ich mich endlich auf Stephen Kings Fantasy-Epos »Der dunkle Turm« einließ – und es hat mich nicht mehr losgelassen. Natürlich hat der achtbändige Zyklus (inklusive einer Novelle) nur wenig mit herkömmlicher Fantasy zu tun: »Der dunkle Turm« ist – meinem Laienurteil nach – viel düsterer, Anfangs mit Western-Anleihen, später mit Science Fiction und Horror, vor alle aber sind »Schwarz«, »Drei«, »Tot«, »Glas«, »Wind«, »Wolfsmond«, »Susannah«, »Der Turm« sowie »Die kleinen Schwestern von Eluria«, die die Geschichte des Revolvermann Roland Deschain in Mittwelt erzählen, dank mannigfaltiger Querverweise mit nahezu allen anderen Romanen von King verbunden (die ja ohnehin vielfach miteinander verwoben sind).
Manche Zusammenhänge lassen sich erst nach der Lektüre der originären Geschichten um den dunklen Turm erschließen, aber erst dieses Wiederentdecken von Figuren, Orten, Ereignissen, dieses Alles-hat-mit-allem-zu-tun machte für mich »Der dunkel Turm« erst zu einem einzigartigen Leseerlebnis.
Kurzum: Was King hier geschaffen hat, ist großartig, überwältigend, und manchmal verdammt anrührend. Bis heute kann ich die Angst nicht vergessen, die ich bei der Lektüre von "Es" empfunden habe. Die Tränen, die ich bei »Glas« vergossen habe, bleiben ebenso unvergesslich.
Stephen King: Der dunkle Turm (1982-2012)
My history of bookshelf (21): »Psycho« von Robert Bloch
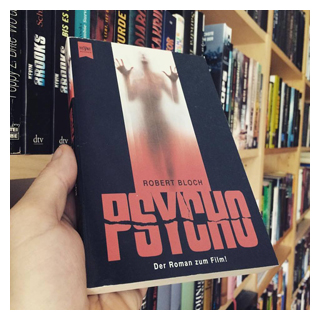 Ähnlich wie "Der Exorzist", über den ich es letzte Woche hatte, ist auch "Psycho" als Film berühmter als das Buch von Robert Bloch. Zu Unrecht.
Ähnlich wie "Der Exorzist", über den ich es letzte Woche hatte, ist auch "Psycho" als Film berühmter als das Buch von Robert Bloch. Zu Unrecht.
Zugegeben, auch ich habe damals den Hitchcock-Klassiker gesehen, und erst viel später das Buch entdeckt. Umso überraschter war ich, dass sich Film und Buch unterscheiden. Schon gleich zu Beginn: "Sowie Mary das dicke, bebrillte Gesicht sah und die leise, zaghafte Stimme hörte, war ihr Entschluß gefaßt. Hier [in dem Motel] konnte sie unbesorgt übernachten." Der Buch-Norman-Bates ist ein versoffener, kahlköpfiger Fettsack, der rein gar nichts mit dem attraktiven, von Anthony Perkins verkörperten Film-Norman-Bates.
Im Film ist die Duschszene (mehr oder weniger) Dreh- und Angelpunkt, im Buch nur ein rasch abgehandelter Moment. Zwar umfasst das Buch auch nur knappe 190 Seiten, dennoch gelingt Robert Bloch ein ungleich spannenderes, böses Psychodrama, das durch ständige Handlungsprünge ein irres Tempo bis zum finalen Clou besitzt. "Lila drehte sich um und starrte die fette, unförmige Gestalt an, die dort oben stand, halb verhüllt durch das enge Kleid, das auf absurde Weise nach unten gezerrt war, um die Hose zu verbergen. Sie starrte das Kopftuch an, das Gesicht in den Falten, das weißgeschminkte, zu einem verzierten Lächeln verzogene Gesicht. Sie starrte die grellroten Lippen an und dsah, wie sie sich in einer krampfhaten Grimasse öffneten.
'Ich bin Norma Bates', sagte die hohe, schrille Stimme."
Natürlich war mir das schockierende Aha-Erlebnis durch den Film vorwegnommen worden, das trübte meinen Lesegenuß. Zugleich war es mir aber auch eine Lehre: Fortan las ich erst die Bücher, bevor ich mir entsprechende Verfilmungen anschaute.
Robert Bloch: Psycho (1959)
My history of bookshelf (20): »Der Exorzist« von William P. Blatty
 Wahrscheinlich einer jener Fälle, in denen der Film – lange Zeit einer der erfolgreichsten Horrorfilme – bekannter ist als das Buch. Völlig zu Unrecht: "Der Exorzist" von William P. Blatty gilt als Vorläufer jener Generation von Horrorautoren, die in den 80-ern der phantastischen Literatur zu neuem Renommé verhalfen.
Wahrscheinlich einer jener Fälle, in denen der Film – lange Zeit einer der erfolgreichsten Horrorfilme – bekannter ist als das Buch. Völlig zu Unrecht: "Der Exorzist" von William P. Blatty gilt als Vorläufer jener Generation von Horrorautoren, die in den 80-ern der phantastischen Literatur zu neuem Renommé verhalfen.
Der altorientalische Dämon Pazuzu ergreift Besitz von der zwölfjährigen Regan. Die Ärzte verzweifeln. Die Kirche schickt zwei Jesuitenpater, den alten, herzkranken Lankaster Merrin, der bereits einmal gegen Pazuzu kämpfte, und Damien Karras, der selber von den Dämonen seiner Vergangenheit heimgesucht wird.
Hemmungsloses Herumurinieren, Masturbationen via Kruzifix, Sprechen in vergessenen Sprachen sowie Kirchenschändungen und ein grausiger Mord fügen sich zu einem teuflischen Gesamtbild, verborgen hinter der Fassade eines minderjährigen Opfers. Merrin und Karras vollziehen den Exorzismus, der ihnen beiden den Tod bringt, dem Mädchen aber die Rettung.
"Der Exorzist" ist dank seiner Charaktere spannend, überzeugt durch tiefgründige Kenntnisse des kirchlichen Gedankenguts, obgleich der Grundtenor – einzig die Kirche bewahrt die Menschen vor dem Bösen – etwas zu viel Heilsgläubigkeit verspricht. Aber das tut der Wirkung des Romans keinen Abbruch.
William P. Blatty: Der Exorzist (1971)
My history of bookshelf (19): Die Horror-Romane von John Saul
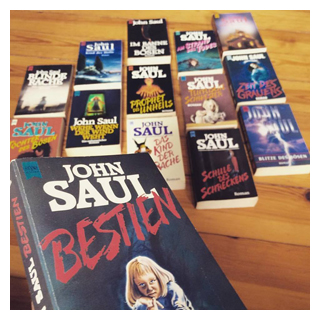 Ja, ich gebe zu, ich habe John Saul gelesen. Und ja, ich habe es sogar mit großer Begeisterung getan. Aber hey, ich war jung und unschuldig.
Ja, ich gebe zu, ich habe John Saul gelesen. Und ja, ich habe es sogar mit großer Begeisterung getan. Aber hey, ich war jung und unschuldig.
Allerdings ließ meine Faszination nach einer Weile wieder nach, weil mir klar wurde, dass man, wenn man eine Saul-Roman kennt, im Prinzip alle kennt.
Das Saul-Prinzip ist denkbar einfach: Ein Kind steht nach Trennung der Eltern bzw. dem Tod eines Elternteils und einem entsprechenden Umzug an einen fremden Ort allein auf weiter Flur, manchmal misshandelt, ansonsten gebeutelt durch soziale Zwänge. Während die Erwachsenen um Integration in die von Konventionen geprägte Umgebung bemüht sind, werden die Bedürfnisse des Kindes missachtet. Da die Einfügung des Kindes in die kleine Gemeinschaft des Dorfes misslingt, bleibt es schutzlos zurück und ist dem Grauen hilflos ausgeliefert, wahlweise Geistererscheinungen, Sekten, nicht selten ein Psychopath, der - natürlich - seine durch ein absonderliches Ereignis aus der Kindheit ausgelöste Psychose an dem Kind auslebt.
Das alles setzt Saul effekthaschend in Szene. Grautöne sucht man bei ihm vergeblich. »Leichtverdauliche Formulierungen, die nicht zu hochgeistig werden, könnte es doch dann geschehen, dass der Leser vor lauter Denken das Fürchten vergisst«, brachte es ein Kritiker seinerzeit auf den Punkt.
Dementsprechend eindeutig waren auch die Titel und Titelbilder der Saul-Romane: »Bestien«, »Prophet des Unheils«, »Schule des Schreckens«, »Teuflische Schwester« - gerichtet an die schnellen Leser, die nur eines im Kopf haben: Psycho, Grauen, Horror - und gerne bitte auch viel Blut.
Meine Zeit des Saul-Horrors währte nur kurz, aber zugegeben, sie war spannend.
John Saul: Bestien (1989)
My history of bookshelf (18): »Amok«, »Todesmarsch«, »Sprengstoff«, »Menschenjagd« und »Der Fluch« von Richard Bachman
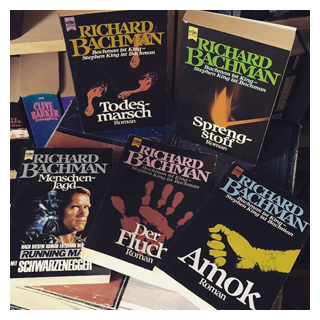 Stephen King ohne Richard Bachmann? Geht nicht. Denn King ist Bachman. Und Bachman ist anders.
Stephen King ohne Richard Bachmann? Geht nicht. Denn King ist Bachman. Und Bachman ist anders.
Nach dem Erfolg von »Carrie«, »Brennen muss Salem« und »Shining« glaubte der Verlag, der Markt wäre zu schnell übersättigt von King. Dem war‘s recht, wollte er doch testen, ob sich seine Romane auch verkaufen, wenn nicht »King« auf dem Cover steht.
Es erschienen vier Bücher, die er lange vor »Carrie« geschrieben hatte und die sich deshalb auch davon abheben. Ihnen liegt eine sozialkritische Haltung zugrunde: Menschen, die zum Zwecke der Unterhaltung in den Tod geschickt werden (»Menschenjagd«); Menschen, die Cola schlürfend dabei zusehen (»Todesmarsch«), Menschen, denen alles wichtiger ist als die Ängste, Nöte und Belange ihrer Mitmenschen (»Amok«, »Sprengstoff«). Die Kluft zwischen Arm und Reich, Macht und Ohnmacht ist groß, und die Wahrheit hinter allem ist: Wer den größten Knüppel hat, hat die meiste Macht. Kings Helden lehnen sich auf - und werden für verrückt erklärt. Aber in Wirklichkeit sie sind nur ein Opfer einer verrückten Gesellschaft. Sie versuchen, normal zu sein, aber in einer falschen Welt kann Normalität sehr, sehr gefährlich werden. Einzig das fünfte Bachman-Buch, »Der Fluch«, entstand, als King schon erfolgreich war, und entspricht dank des übersinnlichen Elements eher dem typischen King-Style. Was findige Leser bemerken - und das Bachman-Pseudonym enthüllen. Verkauften sich die Bücher bislang nur mäßig, landeten sie jetzt auf den Bestsellerlisten.
Die Ereignisse um und Erlebnisse mit Bachman verarbeitete King 1989 in dem Roman »Stark«, in dem ein enttarnter Schriftsteller von seinem medienwirksam begrabenen Pseudonym heimgesucht wird. 1996 lebte Bachman überraschend wieder auf, als auf einen Schlag »Desperation« (als King) und »Regulator« (als Bachman) erschienen – ein einzigartiges Experiment. Dazu demnächst mehr.
Übrigens: »Amok« hat King aufgrund seiner Thematik und der bitteren Realität – ein Schüler, der Amok läuft – mittlerweile vom Markt nehmen lassen.
Richard Bachman: Amok (1977), Todesmarsch (1979), Sprengstoff (1981), Menschenjagd (1982), Der Fluch (1984)
My history of bookshelf (17): »Dracula« von Bramd Stoker, »Brennen muss Salem« von Stephen King, »Anno Dracula« von Kim Newman
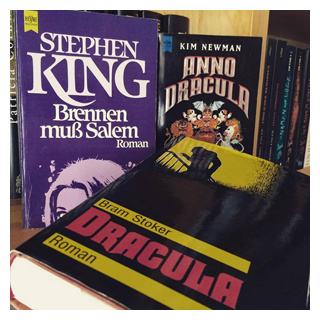 Vergesst Twilight, vergesst Blade - es gibt nur einen Vampir. Bram Stokers »Dracula«. Auch wenn es damals, ich war 14 oder 15, nicht der erste Vampirroman war, den ich las, so ist er mir von allen am besten, weil am spannendsten in Erinnerung geblieben - wohl auch wegen seiner ungewöhnlichen Erzählform.
Vergesst Twilight, vergesst Blade - es gibt nur einen Vampir. Bram Stokers »Dracula«. Auch wenn es damals, ich war 14 oder 15, nicht der erste Vampirroman war, den ich las, so ist er mir von allen am besten, weil am spannendsten in Erinnerung geblieben - wohl auch wegen seiner ungewöhnlichen Erzählform.
Im ersten Teil schildert Jonathan Harker in Briefen und Tagebucheinträgen, wie er nach Transsylvanien reist, um dem Grafen Dracula die Papiere über einen Grundstückskauf in London zu überbringen. Harker stirbt, und Dracula reist an seiner Stelle nach London. Im zweiten Teil macht sich Dr. van Helsing auf die Jagd nach 50 mit Heimaterde gefüllten Särgen, in denen sich Dracula jeden Morgen zur Ruhe legt, da er als Vampir das Tageslicht meidet. Helsing gelingt es, den Blutfürsten zu stellen. Er bringt ihn mit der zwar nicht von Stoker erfundenen, aber erstmals kodifizierten Form mit dem Holzpfahl um.
Stephen Kings »Brennen muss Salem« ist eine moderne Neuinterpretation des Dracula-Mythos. King macht, was er am besten kann, und verlegt seine Geschichte in die alltägliche Wirklichkeit einer verschlafenen Kleinstadt, wo er mit unseren typischen Ängsten spielt. Veräußerlicht werden diese durch den Vampir, der schleichend seine üble Saat verbreitet. Wenn überhaupt macht dies den Reiz des Romans aus, der für mich aber nicht an die Großartigkeit von Stokers Vorlage heranreicht.
Ungleich gewitzter empfand ich Kim Newmans »Anno Dracula«: Sein Roman knüpft an die Geschehnisse aus Stokers »Dracula« an, mit dem Unterschied, dass van Helsing dem transsylvanischen Fürsten erlegen ist, Dracula hiernach König von Großbritannien. Zu seinen Ministern ernennt er die aus den Vampirromanen der Schriftstellerkollegen bekannten Vampire. Vampirhuren bieten ihre Dienste gegen ein Maulvoll Blut an, bis sie eines Tages ein Schlitzer meuchelt. Jack The Ripper im Kampf gegen die Vampire!
Bram Stoker: Dracula (1897), Stephen King: Brennen muss Salem (1979), Kim Newman: Anno Dracula (1992)
My history of bookshelf (16): »Hellraiser« von Clive Barker
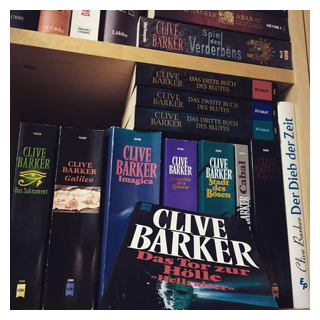 Mit Stephen King begann für mich eine phantastische Zeit. Mit King brach eine wahre Horrorwelle über den internationalen Buchmarkt herein. Einer der ersten Autoren, die ich für mich entdeckte, war Clive Barker, auch weil King selber Barker empfahl: »Ich habe die Zukunft des Horrors gesehen.«
Mit Stephen King begann für mich eine phantastische Zeit. Mit King brach eine wahre Horrorwelle über den internationalen Buchmarkt herein. Einer der ersten Autoren, die ich für mich entdeckte, war Clive Barker, auch weil King selber Barker empfahl: »Ich habe die Zukunft des Horrors gesehen.«
Entdeckt wurde Barker mit seinen sechs »Bücher des Blutes«, sechs Sammlungen nur mit Kurzgeschichten, die, anders als bei King, nicht im Hier und Jetzt verankert sind, sondern die uns aus bekannten Zusammenhängen herausführen in eine ganz andere, vollkommen neue und fremde Welt. Irgendjemand bezeichnete King einmal als »Chronist der Friedhöfe«. Barker ist der der Schlachthöfe.
Sein berühmtester Roman ist »Hellraiser«, nur eine kleine Novelle, dennoch ein Meilenstein nicht zuletzt dank Verfilmung durch Barker selbst: Mithilfe eines Zauberwürfels öffnet sich die Tür in eine andere Dimension, in der die Zenobiten die ultimative Ekstase offerieren. Dummerweise führt kein Weg zurück. »Hellraiser« ist eine Blutorgie, und zugleich die Geburt von Pinhead. Wer kennt ihn nicht?
Mir persönlich haben Barkers »Cabal« und »Gyre« deutlich besser gefallen, weil sie von jener Halbwelt erzählen, die den Spiegel unserer Heile-Welt-Träume darstellt. Das war näher dran am Kingschen Realismus, auch wenn Barker stets einen (oder vielleicht mehrere) Schritt(e) weitergeht. King überlässt den eigentlichen Horror der Phantasie seiner Leser, seine Monster sind am Ende meist menschlich. Barker dagegen gestaltet Monstrositäten seitenlang in allen Details aus, bis dem Leser nichts anderes übrigbleibt, als möglichst viel sofort wieder zu vergessen.
Alles in allem habe ich zu Barker nicht wirklich Zugang gefunden. Andere Horrorautoren haben mich mehr begeistert. Mehr dazu schon bald.
Clive Barker: Hellraiser (1986)
My history of bookshelf (15): »Dolores« & »Das Spiel« von Stephen King
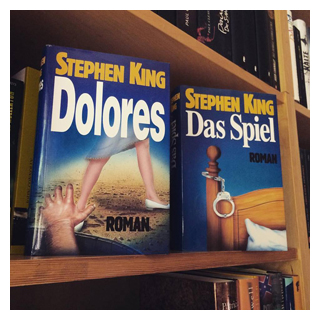 Zwei Romane, die sicher nicht zu den berühmtesten Werken Stephen Kings gehören (obwohl »Dolores« kongenial mit Kathy Bates verfilmt wurde), die mich seinerzeit dennoch nachhaltig geprägt haben: Beide Romane kommen ohne übersinnliche Erscheinung aus (von einer kurzen Vision abgesehen, die beide verbindet), gerade deshalb wirken sie umso eindringlicher. In »Das Spiel« hat Jessie Burlingame mit ihrem Ehemann Gerald ein Schäferstündchen, allerdings kein gewöhnliches Liebesspiel. Doch als sie mit Handschellen ans Bett gefesselt ist, wird ihr klar, dass sie Gerald nach 17 Jahren Ehe satt hat. Da ist es aber schon zu spät, denn erst ist Gerald obergeil, dann infolge eines Herzinfarkts mausetot.
Zwei Romane, die sicher nicht zu den berühmtesten Werken Stephen Kings gehören (obwohl »Dolores« kongenial mit Kathy Bates verfilmt wurde), die mich seinerzeit dennoch nachhaltig geprägt haben: Beide Romane kommen ohne übersinnliche Erscheinung aus (von einer kurzen Vision abgesehen, die beide verbindet), gerade deshalb wirken sie umso eindringlicher. In »Das Spiel« hat Jessie Burlingame mit ihrem Ehemann Gerald ein Schäferstündchen, allerdings kein gewöhnliches Liebesspiel. Doch als sie mit Handschellen ans Bett gefesselt ist, wird ihr klar, dass sie Gerald nach 17 Jahren Ehe satt hat. Da ist es aber schon zu spät, denn erst ist Gerald obergeil, dann infolge eines Herzinfarkts mausetot.
Während er vor ihr verfault (und zur Hundemahlzeit wird), bemüht sich Jessie zwei Drittel des Romans von ihren Fesseln zu befreien. Natürlich geht es King um mehr als nur darum. Ihm gelingt eine nicht minder spannende Charakterstudie einer vom Leben enttäuschten Frau.
Während sie um ihre Befreiung kämpft, denkt Jessie über ihr Leben nach. Personen suchen sie in ihren Träumen heim, Visionen quälen sie, unter anderem von einem Brombeerdickicht, wo eine Frau neben einem gesplitterten Bretterboden kniet. Diese Frau ist »Dolores«, Dolores Claiborne, Heldin gleichnamigen Romans, die gerade ihren verhassten Ehemann beseitigt hat. King schildert auch ihr Leben, und die Dämonen der Seele, die in der Psyche der Menschen und in ihren Mitmenschen begraben liegen: Misshandlung, Vergewaltigung, psychische Folter. King macht dies auf eindringliche Weise, dass es seine Befähigung zum »echten« Literaten unter Beweis stellt. Selbst strenge King-Kritiker sahen in »Dolores« eine »gelungene Leistung und ganz sicher nicht die Art von Roman, die man von einem Schriftsteller wie King erwarten würde«.
Was wohl auch der Grund war, warum die Verkaufszahlen deutlich hinter anderen Werken zurückblieben. Zu Unrecht, denn »Dolores« ist wie »Das Spiel« ein einfühlsames Porträt einer Frau, der das Leben und die Männer übel mitspielen, die aber darum kämpft, zu triumphieren.
Stephen King: Dolores/Das Spiel (1987)
My history of bookshelf (14): »Friedhof der Kuscheltiere« von Stephen King
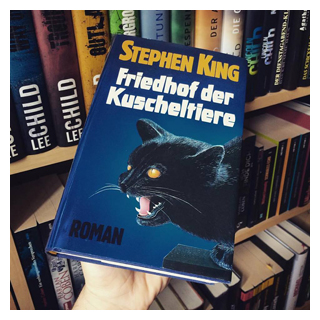 Ich weiß noch, wie ich damals wütend dachte: Ein offenes Ende? Das geht ja gar nicht! Nicht nur in dieser Hinsicht ist »Friedhof der Kuscheltiere« eine Premiere. Es ist auch das erste Buch, in dem Stephen King bewusst eines der zentralen Themen der Horror-Literatur aufgreift: Tod. Der Verlust geliebter Menschen, die Trauer und die Isolation, die damit einhergehen. Noch schlimmer: Protagonist Dr. Louis Creed, ein Arzt, der es eigentlich hätte besser wissen müssen, symbolisiert die Einstellung der modernen, aufgeklärten Menschen, er leugnet für sich und seine Familie den Tod. Und macht damit das Erleben desselbigen umso schlimmer.
Ich weiß noch, wie ich damals wütend dachte: Ein offenes Ende? Das geht ja gar nicht! Nicht nur in dieser Hinsicht ist »Friedhof der Kuscheltiere« eine Premiere. Es ist auch das erste Buch, in dem Stephen King bewusst eines der zentralen Themen der Horror-Literatur aufgreift: Tod. Der Verlust geliebter Menschen, die Trauer und die Isolation, die damit einhergehen. Noch schlimmer: Protagonist Dr. Louis Creed, ein Arzt, der es eigentlich hätte besser wissen müssen, symbolisiert die Einstellung der modernen, aufgeklärten Menschen, er leugnet für sich und seine Familie den Tod. Und macht damit das Erleben desselbigen umso schlimmer.
Dabei beginnt alles vielversprechend. Creed kriegt eine neue Stelle, zieht mit Ehefrau Rachel, Sohn Gage und Tochter Ellie in die Kleinstadt Ludlow, wo er ein Haus neben der stark befahrenen Route 15 kauft. Die Idylle ist perfekt. Zu perfekt. Denn das Leben ist grausam. Warum? Darum! Kings Realismus, ich hatte es schon früher erwähnt. Ellies Kater wird vom Laster überfahren – und Nachbar Jud ist es, der Louis den Weg zum alten Tierfriedhof der Micmac-Indianer weist. Dort begraben, taucht der Kater wieder auf, übelriechend und -launig.
Spätestens da hätte Creed es ahnen müssen: »Totes ins Leben zurückholen – viel näher kann man dem Gottspielen nicht kommen, nicht wahr?« Doch wir wissen: Wenn sich der Mensch in den natürlichen Gang der Dinge einmischt, dann stets mit katastrophalen Folgen. Das Ende kommt abrupt. Ein offenes Ende.
Eine kalte Hand legt sich auf Louis‘ Schulter. Eine Stimme knirscht, voller Erde.»Liebling«, sagt sie.
Und Ende.
Stephen King: Friedhof der Kuscheltiere (1983)
My history of bookshelf (13): »Sie« von Stephen King
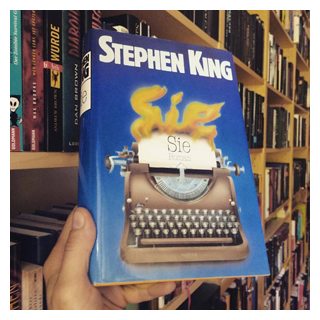 Wer ES sagt, der muss bei Stephen King natürlich auch SIE sagen. SIE, im Original »Misery« ist der endgültige Beweis, dass nicht übernatürlicher Hokuspokus, sondern der Mensch das eigentliche Monster auf Erden ist.
Wer ES sagt, der muss bei Stephen King natürlich auch SIE sagen. SIE, im Original »Misery« ist der endgültige Beweis, dass nicht übernatürlicher Hokuspokus, sondern der Mensch das eigentliche Monster auf Erden ist.
In SIE arbeitet King die Erfahrung eines populären Schriftstellers mit fanatischen Fans auf. SIE ist das Pendant zu »Shining«. Während es dort für den erfolglosen Schriftsteller Jack der innere Schrecken ist, der ihn zerbricht, ist es in SIE für den Starautor Paul Sheldon der Schrecken von außen, der ihn zerhackstückt.
Sheldon ist Bestsellerautor von Liebesromanen um die Heldin Misery Chastain, der er inzwischen mehr als überdrüssig ist. In dem Roman »Miserys Kind« lässt er seine Heldin sterben und schreibt einen neuen Roman mit dem orakelhaften Namen »Schnelle Autos«. In der freudigen Erwartung, dass dieser Roman ihm endlich die ersehnte Aufmerksamkeit der Kritiker beschert, ist es ausgerechnet sein Auto, ein 1974er Camarao, das ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Er verunglückt in einem Schneesturm, und wird schwer verletzt gerettet von der durchgeknallten Krankenschwester Annie Wilkes, die sich ausgerechnet als sein »Fan Nummer 1« bezeichnet. Natürlich ist sie alles andere als einverstanden mit Miserys Tod.
Mit allerlei fiesen Überraschungen zwingt sie Sheldon, eine Misery-Fortsetzung zu schreiben - eine Metapher auf Kings Leser, die jedes Jahr nach einem neuen Horrorknüller verlangen. An dieser Stelle durchschaut Sheldon (King?) aber auch zum ersten Mal seine Leserschaft: »Annie Wilkes war das perfekte Publikum, eine Frau, die Geschichten liebte, ohne das geringste Interesse für die Mechanismen aufzubringen, wie sie zustande kamen.«
SIE ist 1987 erschienen, und aktuell wie eh und je.
Stephen King: Sie (1987)
My history of bookshelf (12): »Es« von Stephen King
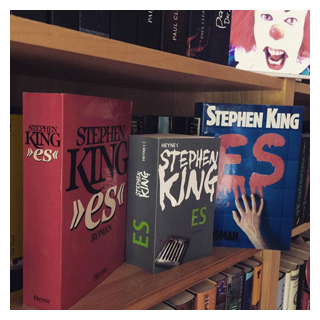 Hand aufs Herz: Wem ist es nicht so ergangen? Bis in die tiefe Nacht gelesen, begeistert, schockiert, verängstigt – und mit einer unerträglich vollen Blase, weil man sich nicht auf die Toilette traute, aus Angst, dass auf dem Weg dorthin Pennywise durch eines der Fenster in die dunkle Wohnung grinst. Noch nie hatte mich ein Buch dermaßen gefesselt so wie Stephen Kings ES. Von diesem Tag an, 1986, wollte ich endgültig Schriftsteller werden und Leser ebenso mit Geschichten fesseln können.
Hand aufs Herz: Wem ist es nicht so ergangen? Bis in die tiefe Nacht gelesen, begeistert, schockiert, verängstigt – und mit einer unerträglich vollen Blase, weil man sich nicht auf die Toilette traute, aus Angst, dass auf dem Weg dorthin Pennywise durch eines der Fenster in die dunkle Wohnung grinst. Noch nie hatte mich ein Buch dermaßen gefesselt so wie Stephen Kings ES. Von diesem Tag an, 1986, wollte ich endgültig Schriftsteller werden und Leser ebenso mit Geschichten fesseln können.
King selbst sieht ES als »Summe all dessen, was ich in meinem Leben getan und gelernt habe«. Und tatsächlich: Als wäre ES die Summe aller seiner bis dato veröffentlichten Werke, also quasi die Quintessenz, erwischt ES seine Leser eiskalt im Nacken.
King erklärt, worin der Erfolg von ES liegt: »ES handelt eigentlich gar nicht von ES oder Ungeheuern oder sowas. Es handelt von der Kindheit und meiner Vorstellung, wie man die eigene Kindheit erlebt und sie letztendlich wegstecken und ein Erwachsener werden kann.«
Was also ist ES? ES ist ein aus dem Weltraum kommendes, alterloses Wesen (Cthulu läßt grüßen), das seit Jahrhunderten im Abwassersystem der Stadt haust, alle 27 Jahre an die Oberfläche kommt und bevorzugt kleine Kinder goutiert. ES kennt ihre Ängste, und weil es sich beliebig verwandeln kann, gibt ES allen menschlichen Schreckensphantasien eine reale Gestalt. Dabei lernt der Leser ES zuallererst als Clown Pennywise kennen.
Sieben Freunde nehmen den Kampf auf. Sie nennen sich »Club der Verlierer«. Sie sind Außenseiter, ein Mischmasch aus allen Mankos, die man Kind als fürchtet: der eine zum Beispiel stottert, der andere ist dick, noch einer trägt eine Brille, und das Mädchen wird von ihrem Vater misshandelt. Sieben Freunde, die sich finden, die kurzen Momente des Glücks (Liebe, Treue und Loyalität) genießen, ihren Widrigkeiten trotzen - und schließlich gemeinsam ES besiegen.
Aber ist ES damit besiegt? Offensichtlich. Ein Happy-End gibt es dennoch nicht. Am Ende obsiegt das Vergessen über die Kindheit - denn das Paradies der Kindheit, das wissen wir, ist irgendwann für immer verloren. So ist das Leben.
Stephen King: Es (1986)
My history of bookshelf (11): »Shining« von Stephen King
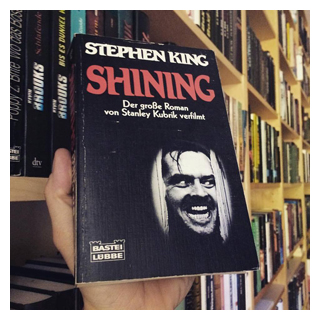 Schwer zu sagen, was am Ende erfolgreicher war: 1980 die großartige Verfilmung von Stanley Kubrick mit Jack Nicholson in der Hauptrolle (die cineastische Umsetzung, mit der King nie zufrieden war), oder die literarische Vorlage, die in die Abgründe menschlicher Seelen entführt. Unzweifelhaft ist: Mit »Shining« gelang King endgültig der literarische Durchbruch, mit dem er seine ganzen Stärken und Qualitäten auf einmal zeigt: »Eine lebhafte Phantasie, eine kraftvolle Erzählweise, lebendige Charaktere, ein interessanter Handlungsschauplatz und das zwangsläufige Eindringen des Bösen«, erklärt King-Biograph George Beahm.
Schwer zu sagen, was am Ende erfolgreicher war: 1980 die großartige Verfilmung von Stanley Kubrick mit Jack Nicholson in der Hauptrolle (die cineastische Umsetzung, mit der King nie zufrieden war), oder die literarische Vorlage, die in die Abgründe menschlicher Seelen entführt. Unzweifelhaft ist: Mit »Shining« gelang King endgültig der literarische Durchbruch, mit dem er seine ganzen Stärken und Qualitäten auf einmal zeigt: »Eine lebhafte Phantasie, eine kraftvolle Erzählweise, lebendige Charaktere, ein interessanter Handlungsschauplatz und das zwangsläufige Eindringen des Bösen«, erklärt King-Biograph George Beahm.
Die Geschichte ist hinlänglich bekannt: der gefeuerte Lehrer und erfolglose Schriftsteller Jack Torrance, der vom Alkohol gezeichnet mit Ehefrau Wendy und Sohnemann Danny im abgelegenen Overlook-Hotel eine Stelle als Hausmeister für den Winter antritt. Abgeschieden vom Rest der Welt kommt das Monster diesmal nicht von außen, es entwickelt sich von innen heraus. Der Schrecken sitzt in Jacks Seele, ihren Zwängen, ihren Alpträumen, der Paranoia.
»›Shining‹ ist der erste Roman Kings, in dem sich der Verfall der amerikanischen Gesellschaft symbolisch auf der kleinsten Ebene abspielt«, so der langjährige King-Übersetzer Joachim Körber, »nämlich im Zerfall der Familie als unterste Einheit eines funktionierenden gesellschaftlichen Gebildes.« Gerade das macht Kings zelebrierten Realismus so furchterregend.
Ganz ohne Übernatürliches geht es freilich auch in »Shining« nicht: Jacks Sohn Danny besitzt die Gabe, das »Shining«, mit der er flüchtige Blicke in die Zukunft werfen kann. »Redrum« liest er in seinen Visionen - und ich weiß noch ganz genau, wie es mir eiskalt den Rücken runterlief, als ich damals endlich die Bedeutung begriff. Redrum. Murder. Mord.
Übrigens: Dannys einziger Verbündeter ist der Hotelkoch Dick Hallorann. Dessen Vorleben erzählt King in seinem späteren Wälzer »Es«. Doch dazu nächste Woche mehr ...
Stephen King: Shining (1980)
My history of bookshelf (10): »Cujo«, »Christine« & »Feuerkind« von Stephen King
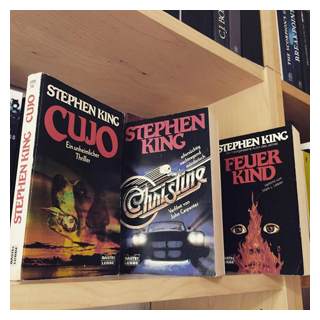 Nachdem mich »Carrie« damals mit den King-Fieber infiziert hatte, las ich in schneller Folge alles, was ich von dem »King of Horror« finden konnte.
Nachdem mich »Carrie« damals mit den King-Fieber infiziert hatte, las ich in schneller Folge alles, was ich von dem »King of Horror« finden konnte.
»Cujo« war für mich, der ich als Kind furchtbare Angst vor Hunden hatte (kein Scherz!), der absolute Horror. Der Roman verzichtet auf übernatürliches Beiwerk und bietet ein Gesellschaftsporträt herzensguter Menschen, denen das Schicksal jede Menge Pech zugedacht hat: gescheiterte Ehen, finanzieller Ruin - die Kraft von »Cujo« - ein tollwütiger Hund tyrannisiert eine junge Mutter mit Kind, die bei Bullenhitze in ihrem Auto eingeschlossen sind - liegt im realen Schrecken des alltäglichen Lebens. Und auf dessen Schilderung versteht sich King ja ganz besonders.
Das gilt auch für »Christine«: das typisch amerikanische Kleinstadtleben an einer High School, Teenager, deren Schritt ins Erwachsensein noch nicht ganz vollzogen ist, Rock’n’Roll und erster Sex auf der Rückbank von Papas Auto. Durch diese vertraute Szenerie stolpert Arnie, ein Außenseiter, der sein Auto liebt, ein 1958er Plymouth Fury, genannt Christine. Als er sich jedoch in ein Mädchen verguckt, entwickelt Christine ein eifersüchtiges Eigenleben ...
Dass King auch politisch kann, bewies er mit »Feuerkind«, das die zweifelhaften Ereignisse der siebziger Jahre, insbesondere Watergate und die Machtvollkommenheit der Geheimdienste, der eigentliche Horror damaliger Zeit, thematisiert. Militärische Experimente an Studenten wecken deren übersinnliche Fähigkeiten – und gipfeln in deren Tochter Charlie, die mittels Gedanken Feuer entfachen kann. »Feuerkind« ist mehr als nur ein PSI-Thriller, auch diesmal geht um unsere Ur-Ängste: die Angst, ein behindertes Kind zu bekommen, die Angst, unser Kind zu verlieren, schließlich auch die Angst des Kindes um seinen Vater oder seine Eltern, die Angst vor dem Missbrauch des Kindes und ganz allgemein vor der Welt, vor den Institutionen einer Gesellschaft, für die ein einzelner Mensch nichts mehr zählt und die über Leichen gehen, um ihre Ziele zu verwirklichen.
Man sieht: Kings Romane sind bis heute aktuell.
Stephen King: Feuerkind (1980), Cujo (1981), Christine (1983)
My history of bookshelf (9): »Carrie« von Stephen King
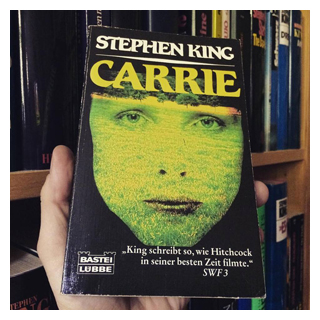 Es gibt drei AutorInnen, die mich zum Schreiben brachten. Karl May. Agatha Christie. Vor allem aber Stephen King. Weswegen ich mich ihm und seinem Werk konsequenterweise in mehreren Beiträgen widmen werde.
Es gibt drei AutorInnen, die mich zum Schreiben brachten. Karl May. Agatha Christie. Vor allem aber Stephen King. Weswegen ich mich ihm und seinem Werk konsequenterweise in mehreren Beiträgen widmen werde.
Entdeckt habe ich King im Alter von 15 oder 16. Mein King-Debüt war zugleich auch Kings Erstling, und »Carrie« packte mich auf Anhieb. Ähnlich wie die titelgebende Hauptfigur, Carietta White, war auch ich als Schüler ein kleiner Sonderling. Ich erkannte mich in ihr wieder. Und genau das machte meine Begeisterung für das Buch und fortan für King aus. Kritiker mochten ihm »flachen, Umgangssprache und poetische Klischees gekonnt mischenden Stil« vorwerfen, aber King schrieb die Sprache seiner Leser. Er brachte ihre Probleme auf den Punkt - religiösen Fundamentalismus, soziale Probleme, unterdrückte Wut und Angst. »Carrie« ist heute noch so aktuell wie bei Erscheinen 1974.
Carrie ist ein häßliches Entlein, der Prototyp des Außenseiters, Tochter der religiös fanatischen Margarete White und Opfer einer heuchlerischen Gesellschaft, die Konformität zum höchsten Gut erhebt und keinen Platz für Abweichler hat. Wenn Carrie nicht schon von Geburt an ein Außenseiter wäre, dann würde sie es später wegen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten - Telekinse - werden.
Trotzdem mausert sie sich zu einem wunderschönen Schwan, als ihre Mitschülerin Susan ein schlechtes Gewissen bekommt und ihren eigenen Freund Tommy auffordert, Carrie zum Abschlußball der Schule zu begleiten. Dort wird Carrie zur Ballkönigin gekrönt - und von hasserfüllten Mitschülerinnen übelst gedemütigt. Ihr bleibt - dank telekinetischer Fähigkeiten - nur noch die Möglichkeit zur blutigen Rache, was die Leser wiederum mit größter Genugtuung zur Kenntnis nehmen: »Gibt es einen Leser, der nicht auch gewisse schlechte Erinnerungen an seine Schulzeit hat und den Gedanken, sich für das vermeintlich oder tatsächlich erlittene Unrecht zu rächen, nicht mit einem gewissen süffisanten Genuß hegen würde?« (U. Anton, in: Wer hat Angst vor Stephen King?)
Stephen King: Carrie (1974)
My history of bookshelf (8): »Der Hund von Baskerville« von Sir Arthur Conan Doyle
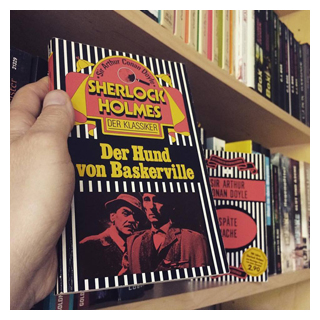 Agatha Christie, von der ich Euch letzte Woche erzählte, war natürlich erst der Anfang. Mit Sir Arthur Conan Doyle und seinem Meisterdetektiv Sherlock Holmes, der dank hipper TV- und Kinoadaptionen inzwischen erfolgreich wiederbelebt worden ist, setzte ich als Teenager meine Entdeckungsreise durch die Kriminalliteratur fort.
Agatha Christie, von der ich Euch letzte Woche erzählte, war natürlich erst der Anfang. Mit Sir Arthur Conan Doyle und seinem Meisterdetektiv Sherlock Holmes, der dank hipper TV- und Kinoadaptionen inzwischen erfolgreich wiederbelebt worden ist, setzte ich als Teenager meine Entdeckungsreise durch die Kriminalliteratur fort.
Allerdings muss ich gestehen, auch auf die Gefahr hin, dass so mancher Krimiliebhaber jetzt den Kopf schüttelt: Mehr Bücher als der berühmte »Hund von Baskerville« sowie »Späte Rache« haben es (bis heute) nicht mehr in meine Bibliothek geschafft. Was nichts über die Qualität der Romane aussagt. Ich erinnere mich noch gut, dass ich beide begeistert gelesen habe.
Dennoch: Nach etlichen Jahren gemeinsam mit Karl May, Jack London, Agatha Christie und jetzt Arthur Conan Doyle verspürte ich immer weniger Lust auf Geschichten, die in längst vergangenen Zeiten verortet waren. Meine Interesse an Spannungsliteratur ließ mich zunehmend mehr zeitgenössische Krimis und Thriller entdecken. Und Romane eines ganz anderen Genres. Aber dazu ein andermal mehr.
Sir Arthur Conan Doyle: Der Hund von Baskerville (1903)
My history of bookshelf (7): »Zehn kleine Negerlein« von Agatha Christie
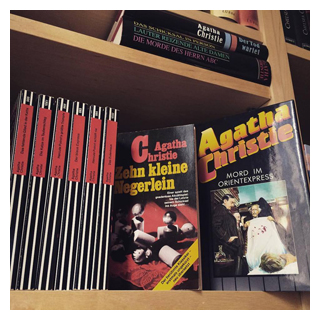 Meine erste Begegnung mit der Kriminalliteratur war - natürlich - Agatha Christie. Sowohl der geniale Detektiv Hercule Poirot als auch die schrullige Rentnerin Miss Marple haben meine Liebe für Spannungsromane geweckt.
Obwohl Christies Whodunnits (fast) alle dem gleichen Strickmuster folgen - vom ersten Mord über ein Dutzend Verdächtiger bis hin zur finalen Auflösung während eines furiosen Sit-Ins -, habe ich über lange Zeit nichts anderes lesen wollen: »Mord im Orientexpress«, »Das fehlende Glied in der Kette«, »Der Wachsblumenstrauß«, »Lauter reizende, alte Damen«, »Die Morde des Herrn ABC« ...
Meine erste Begegnung mit der Kriminalliteratur war - natürlich - Agatha Christie. Sowohl der geniale Detektiv Hercule Poirot als auch die schrullige Rentnerin Miss Marple haben meine Liebe für Spannungsromane geweckt.
Obwohl Christies Whodunnits (fast) alle dem gleichen Strickmuster folgen - vom ersten Mord über ein Dutzend Verdächtiger bis hin zur finalen Auflösung während eines furiosen Sit-Ins -, habe ich über lange Zeit nichts anderes lesen wollen: »Mord im Orientexpress«, »Das fehlende Glied in der Kette«, »Der Wachsblumenstrauß«, »Lauter reizende, alte Damen«, »Die Morde des Herrn ABC« ...
Nachhaltig in Erinnerung geblieben ist mir ausgerechnet ein Roman, der anders funktioniert, auch weil die beiden berühmten Figuren nicht auftauchen: »Zehn kleine Negerlein«, inzwischen politisch korrekt »Und dann gabs keines mehr«.
Auch diese Geschichte greift ein beliebtes Thema auf, das nach wie vor gerne vor allem in Horrorfilmen verwendet wird - abgeschnitten auf einer Insel wird eine überschaubare Anzahl Menschen der Reihe nach dahingemeuchelt - bleibt er an Nervenkitzel unerreicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich den Roman in nur einer Nacht zu Ende las, weil ich mich nicht davon trennen konnte - und morgens meine Mutter ins Zimmer schaute und mich, mit dem Buch in der Hand, völlig entgeistert fragte: »Hast du etwa die ganze Nacht durchgelesen?«
Jüngst habe ich mich mit »Der Tod wartet« wieder an eines der Werke Christies gewagt, musste allerdings rasch erkennen, dass sie mir zu behäbig sind, um nicht zu sagen: langweilig. Nach 50 Seiten habe ich den Roman zugeklappt und beschlossen, dass ich es bei meiner schönen Erinnerung belasse - und der Ehrerbietung in Form meines Pseudonyms.
Agatha Christie: Zehn kleine Negerlein/Und dann gabs keines mehr (1939)
My history of bookshelf (6): »Die Nacht, als der Kojote schwieg« von Werner J. Egli
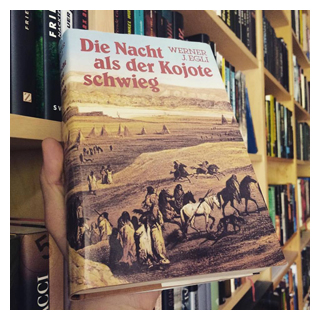 Wie gesagt, mit Karl May erwachte mein Interesse an noch mehr Abenteuern in fernen Ländern, insbesondere an Wildwest- und Indianergeschichten, vor allem aber realistischen Geschichten.
Wie gesagt, mit Karl May erwachte mein Interesse an noch mehr Abenteuern in fernen Ländern, insbesondere an Wildwest- und Indianergeschichten, vor allem aber realistischen Geschichten.
Einer der Autoren, die mich als kleiner Junge viele Jahre lang mit ihren Erzählungen begleitet haben, ist Werner J. Egli. Der Schweizer ist bekannt für seine vielen Kinderbücher, die sich mit dem Leben und Schicksal der nordamerikanischen Ureinwohner auseinandersetzen. Egli hat allerdings auch Romane für Erwachsene geschrieben, einer davon ist »Die Nacht, als der Kojote schwieg«.
Ich habe das Buch gleich bei Erscheinen 1986 gelesen, da war ich 15, und die eindringliche, dramatische Lebensgeschichte des Apachenjungen Kahita ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Viele der Ereignisse, die Egli schildert, sind historisch belegt, und das macht seine Erzählung umso erschütternder.
Der Roman hat noch heute einen Ehrenplatz in meinen Bücherregalen.
Werner J. Egli: Die Nacht, als der Kojote schwieg (1986)
My history of bookshelf (5): »Der Gott seiner Väter« von Jack London
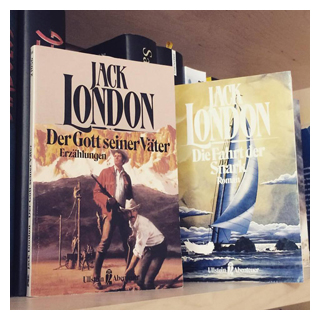 Wie ich schon letzte Woche schrieb: Am Anfang war Karl May. Seine populären Reiseerzählungen, die mich als kleiner Junge nächtelang in den Orient und den Wilden Westen entführten, weckten in mir die Lust auf noch mehr Abenteuer in fernen Ländern. Schon bald stieß ich auf Jack London.
Wie ich schon letzte Woche schrieb: Am Anfang war Karl May. Seine populären Reiseerzählungen, die mich als kleiner Junge nächtelang in den Orient und den Wilden Westen entführten, weckten in mir die Lust auf noch mehr Abenteuer in fernen Ländern. Schon bald stieß ich auf Jack London.
Dessen Geschichten gleichen allerdings nur auf den ersten Blick denen von May. Tatsächlich sind Londons Romane wie »Ruf der Wildnis«, »Wolfsblut« und »Der Seewolf« zweifellos literarischer, mitunter journalistischer, autobiografischer, deshalb vor allem realistischer. Anders als May, dessen Abenteuer reine Phantastereien waren, hat London am eigenen Leib erlebt, worüber er schrieb: gefahrvolle Seereisen, den Goldrausch am Yukon, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn »dieser Körper ist zum Gebrauch geschaffen«, lässt London in »Der Seewolf« wissen, »diese Muskeln sind gemacht, um zuzupacken, um zu zerreißen und zu vernichten, was sich zwischen mich und das Leben stellt.«
Für mich als vorpubertärer Teenager, der bis dahin nur die glorifizierten Helden Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi gewöhnt war, waren Londons Erzählungen harter Tobak. Aber sie schärften zweifellos meinen Blick auf die Welt.
Einen guten Einstieg in das Gesamtwerk Londons bieten der Sammelband »Der Gott seiner Väter« sowie der autobiografische Roman »Die Fahrt der Snark«, (1913), mit denen auch ich seinerzeit London für mich entdeckte.
Jack London: Der Gott seiner Väter (1987)
My history of bookshelf (5): Gesammelten Werke von Karl May
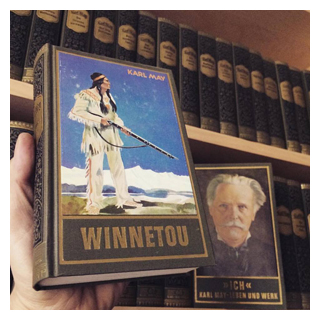 Hand aufs Herz, wer hat sie nicht gelesen, die gesammelten Werke von Karl May? Seine Abenteuer mögen zwar allesamt erstunken und erlogen sein - egal! Seine literarischen Alter Ego Old Shatterhand alias Kara Ben Nemsi sowie deren nicht minder fiktive Begleiter Winnetou, der edle Häuptling der Apatschen, sowie - aufgepasst! - Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah waren die Helden meiner frühen Jugend. Andere Jungs mögen draußen erste, vorpubertäre Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt haben, ich war derweil lieber nächtelang im Wilden Westen und im Orient unterwegs, durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan, durch das Land der Skipetaren. Später habe ich auch die anderen Werke Mays für mich entdeckt, die in Deutschland angesiedelt sind.
Hand aufs Herz, wer hat sie nicht gelesen, die gesammelten Werke von Karl May? Seine Abenteuer mögen zwar allesamt erstunken und erlogen sein - egal! Seine literarischen Alter Ego Old Shatterhand alias Kara Ben Nemsi sowie deren nicht minder fiktive Begleiter Winnetou, der edle Häuptling der Apatschen, sowie - aufgepasst! - Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah waren die Helden meiner frühen Jugend. Andere Jungs mögen draußen erste, vorpubertäre Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt haben, ich war derweil lieber nächtelang im Wilden Westen und im Orient unterwegs, durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan, durch das Land der Skipetaren. Später habe ich auch die anderen Werke Mays für mich entdeckt, die in Deutschland angesiedelt sind.
Bis heute für mich unvergessen ist das Kapitel »Die Todeskarawane« aus dem Buch »Von Bagdad nach Stambul«, in dem May auf eine so eindringliche Art den Anblick und den Gestank des Leichenzugs beschreibt, dass ich danach tagelang Albträume hatte.
Meine Begeisterung für Karl May weckte in mir erstmals auch den Wunsch, selbst Schriftsteller zu werden. Auch ich wollte Leser mit spannenden Geschichten fesseln können - was für eine großartige Kunst! Schon mit elf oder zwölf habe ich mich deshalb an ersten, eigenen Erzählungen versucht, damals noch auf der Schreibmaschine meiner Mutter. »Durch den wilden Niederrhein« und »Von Kevelaer nach Kleve« waren freilich nichts anderes als Kopien der May-Abenteuer. Heute würde man wohl sagen: Plagiate.
Seit einiger Zeit nehme ich mir immer wieder vor, die schönen, grünen Bände aus dem Regal zu ziehen und sie neu zu entdecken. Einzig die Angst hält mich zurück, dass die Abenteuer nicht mehr auf mich wirken wie noch vor 30 Jahren, dass ich vielmehr sogar gelangweilt sein werde - und deshalb lasse ich es immer wieder bleiben und behalte die Geschichten und meine Begeisterung dafür vorerst lieber in guter Erinnerung.
Karl May: Gesammelte Werke (1870ff)
My history of bookshelf (4): »Kleine Kicker - große Klasse« von Hans Wolfram Hockl
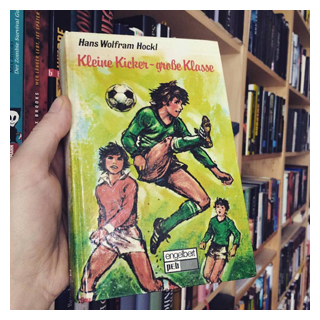 Wie fast jeder kleine Junge habe auch ich früher Fußball gespielt. Jeden Dienstag- und Donnerstagabend bin ich zum Mannschaftstraining geradelt, an den Wochenenden haben uns unsere Eltern zu den Auswärtsspielen gefahren und angefeuert. Natürlich war auch mein Traum die große Bundesligakarriere: »Da wird hart, aber fair um die Fußballmeisterschaft gerungen, da werden persönliche Schicksale in Solidarität mit den Freunden überwunden, da werden aufregende Abenteuer bestanden.« Zum Beispiel eine Verfolgung im Petersdom, eine Entführung in der Wüste Schatt el Hodna, eine Erpressung auf einem Wolkenkratzer in New York.
Wie fast jeder kleine Junge habe auch ich früher Fußball gespielt. Jeden Dienstag- und Donnerstagabend bin ich zum Mannschaftstraining geradelt, an den Wochenenden haben uns unsere Eltern zu den Auswärtsspielen gefahren und angefeuert. Natürlich war auch mein Traum die große Bundesligakarriere: »Da wird hart, aber fair um die Fußballmeisterschaft gerungen, da werden persönliche Schicksale in Solidarität mit den Freunden überwunden, da werden aufregende Abenteuer bestanden.« Zum Beispiel eine Verfolgung im Petersdom, eine Entführung in der Wüste Schatt el Hodna, eine Erpressung auf einem Wolkenkratzer in New York.
Okay, mit dem wahren Fußballgeschäft hat die Geschichte von Hans Wolfram Hockl rein gar nichts zu tun, für mich als kleiner Steppke waren seine kleinen Kicker allerdings ganz große Klasse - und ausreichend Motivation, mir bei Wind und Wetter die Stollenschuhe anzuziehen. Diese habe ich mit 15 an den Nagel gehängt, weil mich Lesen und Schreiben dann doch mehr interessierten. Aber das ist eine andere Geschichte.
Hans Wolfram Hockl: Kleine Kicker - große Klasse (1981)
My history of bookshelf (3): »Professors Zwillinge« von Else Ury
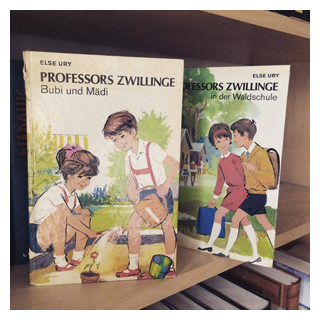 Nach meinem »5 Freunde«-Beitrag letzte Woche gab es einige Leser (keine Leserinnen!), die gestanden, dass sie in ihrer Kindheit rein gar nichts mit Julius, Richard, Anne, Georg und Tim hätten anfangen können, vielmehr seien sie der »Hanni & Nanni«-Typ gewesen. Damit wiederum konnte ich nichts anfangen. Das waren für mich immer - Mädchenbücher.
Nach meinem »5 Freunde«-Beitrag letzte Woche gab es einige Leser (keine Leserinnen!), die gestanden, dass sie in ihrer Kindheit rein gar nichts mit Julius, Richard, Anne, Georg und Tim hätten anfangen können, vielmehr seien sie der »Hanni & Nanni«-Typ gewesen. Damit wiederum konnte ich nichts anfangen. Das waren für mich immer - Mädchenbücher.
Interessanterweise hatte ich keinerlei Probleme mit der »Professors Zwillinge«-Reihe, mit der Autorin Else Ury das Leben von Bubi und Mädi erzählt, die eigentlich Herbert und Suse heißen: ihre unbeschwerte Kindheit, ihre Zeit in der Waldschule, ihre ersten Schritte ins erwachsene Leben. Ich habe die Bücher geliebt.
Noch interessanter aber ist: Bubi und Mädi leben mit ihren Eltern in Berlin in Treptow, wo ihr Vater Paul Winter auf der Sternenwarte als Professor arbeitet. Auch ich lebe heute in Treptow, nur einen Steinwurf von der Sternwarte entfernt.
Else Ury: Professors Zwillinge (1923-1929)
My history of bookshelf (2): »Fünf Freunde« von Enid Blyton
 Was habe ich als kleiner Junge mit ihnen gelitten, gefiebert, geflucht, gelacht, während ich davon überzeugt war, niemals im Leben bessere Freunde zu finden als diese fünf Freunde: »Julius, der für sein Alter besonders groß und stark war, Richard, Georg und Anne. Georg war ein Mädel, kein Junge, aber sie würde nie auf ihren eigentlichen Namen, Georgina, gehört haben. Mit ihrem sommersprossigen Gesicht und dem kurzen lockigen Haar wirkte sie tatsächlich mehr wie ein Junge.« Und dann ist da natürlich noch Tim, Retter in der Not, und überhaupt der beste Freund von allen, nämlich der Hund.
Was habe ich als kleiner Junge mit ihnen gelitten, gefiebert, geflucht, gelacht, während ich davon überzeugt war, niemals im Leben bessere Freunde zu finden als diese fünf Freunde: »Julius, der für sein Alter besonders groß und stark war, Richard, Georg und Anne. Georg war ein Mädel, kein Junge, aber sie würde nie auf ihren eigentlichen Namen, Georgina, gehört haben. Mit ihrem sommersprossigen Gesicht und dem kurzen lockigen Haar wirkte sie tatsächlich mehr wie ein Junge.« Und dann ist da natürlich noch Tim, Retter in der Not, und überhaupt der beste Freund von allen, nämlich der Hund.
Zugegeben, aus heutiger Sicht mögen die Geschichten einem einfachen Strickmuster folgen, und auch die Charaktere kaum über schwarz und weiß hinausreichen. Es mag also sein, dass es viele Kinderbücher gibt, die jungen Lesern ein differenzierteres Weltbild vermitteln. Na und?
Die »5 Freunde«-Serie von Enid Blyton bleibt ein Musterbeispiel für perfekte Spannungsliteratur. Und ich kenne niemanden, der sie in seiner Kindheit nicht auch verschlungen hat.
Enid Blyton: Fünf Freunde ... (1953-1996)
My history of bookshelf (1): »Kai erobert Brixholm« von Rolf Ulrici
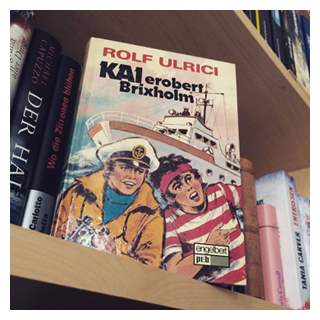 Keine Ahnung, wie oft ich dieses Buch als kleiner Junge gelesen habe. Aber jedes Mal aufs Neue stellte ich mir dabei vor, wie ich in die Rolle von Kai schlüpfe, den es während des Urlaubs mit seinen Eltern per Zufall auf die Ferieninsel Brixholm verschlägt, auf der Kinder Erwachsene spielen. Sie betreiben ihre eigene Eisenbahn, ihre eigene Post, ihre eigenen Geschäfte, eine Flotte von Rettungsbooten, sogar eine eigene Polizei.
Keine Ahnung, wie oft ich dieses Buch als kleiner Junge gelesen habe. Aber jedes Mal aufs Neue stellte ich mir dabei vor, wie ich in die Rolle von Kai schlüpfe, den es während des Urlaubs mit seinen Eltern per Zufall auf die Ferieninsel Brixholm verschlägt, auf der Kinder Erwachsene spielen. Sie betreiben ihre eigene Eisenbahn, ihre eigene Post, ihre eigenen Geschäfte, eine Flotte von Rettungsbooten, sogar eine eigene Polizei.
Mal ehrlich, wer hat sich als Kind nicht einen solchen Ferienort gewünscht, der mehr als nur Spaß und Abwechslung verspricht, sondern – endlich erwachsen sein. Und zwar auf eine verdammt coole Art.
Kais Freude bekommt allerdings einen jähen Dämpfer, als die anderen ihn als Schlauchbootpirat verurteilen. Fortan muss er nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern auch die liebreizende Brixholm-Königin vor einer Intrige bewahren. Denn natürlich ist das vermeintliche Kinderparadies, das Autor Rolf Ulrici entwirft, nur ein Spiegel der Erwachsenenwelt, in der es um Reichtum, Ansehen und Macht geht.
Dass das im Leben alleine aber nicht zählt, ist die bis heute aktuelle Moral der Geschichte, die aber zu keinem Zeitpunkt aufgesetzt wirkt. Dafür bietet Brixholm viel zu viel Spaß, Abwechslung - und natürlich Spannung. Sodass man, als junger Leser, immer wieder gerne dorthin zurückkehrt.
Rolf Ulrici: Kai erobert Brixholm (1960)
© 2011-2018 Martin Krist, Berlin. Impressum. Datzenschutz